Blutgruppen, Eric Aichinger über Taryn Simon in der Neuen Nationalgalerie, Berlin

Taryn Simon, „Auszug aus Kapitel XVI, A Living Man Declared Dead and Other Chapters”, 2011. Foto: David von Becker
Menschenjagd auf Albinos in Tansania, die Fleischwerdung eines göttlichen Wesens in Nepal, eine Blutfehde zwischen zwei Clans in Brasilien – gewiss, Mies van der Rohes lichter „Kunsttempel der Moderne“ lädt ein zu gewichtigen Großinstallationen. Selten zuvor aber spielten sich in der luftigen Oberhalle der Neuen Nationalgalerie in Berlin so viele Schauergeschichten und Tragödien antiken Ausmaßes ab, wie sie Taryn Simon in den 18 Kapiteln ihrer neuen Werkgruppe „A Living Man Declared Dead And Other Chapters“ präsentiert. In jeder dieser Porträtserien sind jeweils Menschen zu sehen, die aufgrund ihrer Blutsverwandtschaft Schicksalsschlägen oder gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt sind. Das Spektrum der von Aberglaube und Gewalt geprägten Familiengeschichten reicht von Reinkarnationsvorstellungen bei den Drusen bis hin zum Genozid in Bosnien.
Ähnlich monumental wie die verhandelten Themen ist auch das Ausstellungsdesign. 18 lange, wuchtige, in funktionalistischem Schwarz gehaltene, an ethnologische Forschungsvitrinen erinnernde Kästen hat der Besucher abzuschreiten. Anders als in diesem Maßstab aber wäre die schiere Menge des Materials wohl auch nicht zu bewältigen gewesen, das die Künstlerin von 2008 bis 2011 in akribischer Recherche auf allen Kontinenten gesammelt hat. Schon der thematische wie präsentationstechnische Umfang überraschen: Bislang galt Überwältigung jedenfalls nicht als wesentlicher Teil von Simons künstlerischer Strategie.
_2_medium.jpg)
Taryn Simon, „A Living Man Declared Dead and Other Chapters“, 2011, Installationsansicht, Neue Nationalgalerie, Berlin. Foto: David von Becker
Die mit Fotografie und Text arbeitende New Yorker Künstlerin Taryn Simon (geboren 1975) hat sich vor allem durch drei Werkgruppen binnen weniger Jahre einen internationalen Ruf erworben. Für „The Innocents“ (2003) interviewte sie ehemalige Häftlinge, meist männliche Afroamerikaner, die von überwiegend weißen Geschworenen auf der Basis fotografischer Dokumente unschuldig verurteilt worden waren. Simon fotografierte die Männer an Schauplätzen, die für das Fehlurteil entscheidend waren, am Tatort etwa oder dort, wo ihnen Zeugen eigentlich ein Alibi gegeben hatten. Im Falle von „An American Index of the Hidden and Unfamiliar“ (2007) beschäftigte sich die Künstlerin mit Orten, Räumen und Objekten, die an der mythisch aufgeladenen, zugleich täglich reproduzierten Identität der USA teilhaben, dabei für die Öffentlichkeit aber unzugänglich bleiben. So fotografierte Simon die Zentrale des Ku-Klux-Klans oder das Vestibül des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia. „Contraband“ (2010) schließlich ist ein Inventar all der Gegenstände, welche die US-Zollbehörde am New Yorker Flughafen JFK in einem Zeitraum von fünf Tagen im November 2009 zusammengetragen hat, die einreisenden Passagieren abgenommen, aus Postsendungen entfernt oder als Schmuggelware beschlagnahmt wurden.
Simon stellte in diesen Arbeiten so angemessene wie brisante Fragen – und dies nicht nur an ein Amerika, das nach 9/11 zunehmend in ein apodiktisches Schwarz-Weiß-Denken verfiel. Auf welchen Grundlagen werden Urteile gefällt? Wie bereitwillig glauben wir an die dünne Beweiskraft des Fotos? (Man erinnere sich hier auch an die fingierten Beweisfotos, die Colin Powell dem UN-Sicherheitsrat vorlegte, um die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak zu belegen, und die damit den entscheidenden Faktor für die vermeintliche Rechtmäßigkeit der Invasion des Iraks bildeten.) Wer hält die systemimmanente und interkulturelle Deutungshoheit über Bilder inne und verfügt damit über die Macht zur visuellen Historiographie und Mythenbildung? Und, am Beispiel des New Yorker Flughafens, wer hat die Definitionsmacht über das als feindlich angesehene Andere, das die Grenze ins Eigene nicht passieren darf? Simons Strategie aus Zeigen und Nicht-Zeigen, textlicher Erklärung und beredten Leerstellen, die auf das Nicht-Sehen-aber-Sehen-Wollen und auf die Imaginationsfähigkeit der Betrachter/innen setzt, geht in diesen Arbeiten auf, weil bei aller spröder Geschlossenheit des Werkansatzes ihr Thema – das Wechselspiel von Fakt und Fiktion bei der Produktion von Wissen – dringlich wird. Was dort stimmt, ist das Verhältnis zwischen der (selbst-reflexiven) Sichtbarmachung von Fragen zu unserem alltäglichen Umgang mit (fotografischen) Bildern einerseits und dem eigenen Anspruch auf eine tatsächliche epistemische Beweiskraft der Fotografie andererseits. Bei der aktuellen, im Hinblick auf Form und Inhalt sehr viel größer angelegten Arbeit in der Neuen Nationalgalerie dagegen verwickelt sich Simon in ein Netz aus unauflösbaren Widersprüchen.
_medium.jpg)
Taryn Simon, „A Living Man Declared Dead and Other Chapters“, 2011, Installationsansicht, Neue Nationalgalerie, Berlin. Foto: David von Becker
Dabei bleibt sie mit „A Living Man Declared Dead“ ihrer Herangehensweise in vielerlei Hinsicht treu, vor allem, was die konzeptualistische Strenge der Form anbelangt. Jedes der 18 Kapitel besteht in einem einheitlich dreiteiligen Aufbau mit einer Sequenz von Porträts auf der linken Seite, einer Texttafel in der Mitte und einem von Simon als „Fußnoten-Bilder“ bezeichneten Bild-Paneel auf der rechten Seite. Die Porträttafeln sind in Reihen angeordnet und zeigen, grob beschrieben, im Alter von links oben nach rechts unten absteigend alle direkten Blutsverwandten der für ein Kapitel zentralen Person. Der Fokus liegt dabei nicht auf Individualportraits, in denen die jeweilige Persönlichkeit durch künstlerische Interpretation hervorgebracht werden soll, sondern auf der systematischen Protokollierung der Personen, die stets demselben strengen Setting folgt: Jedes Familienmitglied wurde von Simon bei gleicher Beleuchtung und gleichem Kameraabstand vor einem elfenbein-beigen Hintergrund sitzend arrangiert und frontal und mit möglichst neutralem Gesichtsausdruck im Dreiviertel-Porträt mit einer Großbildkamera abgebildet. Menschenleere Tafeln, die nur den neutralen Hintergrund zeigen, stehen für lebende Mitglieder der Blutslinie, die aus verschiedenen Gründen nicht fotografiert werden konnten, etwa weil sie als vermisst gelten, krank oder inhaftiert waren oder aber die Teilnahme verweigerten, sei es aus religiösen oder privaten Gründen. Die menschenleeren Tafeln von Kapitel XI, in dem Hans Frank die Schlüsselperson ist, Hitlers Rechtsberater und Generalgouverneur des okkupierten Polen, sind insofern sprechend, als darin mehrfach Stapel von gefalteten Kleidungsgarnituren als persönliche Stellvertreter vorkommen. Die (halbe) Verweigerung der Teilnahme am Projekt führte zu dem interessanten Ergebnis einer Sichtbarmachung des jedem Portrait zugrundeliegenden Strukturmerkmals von Präsenz und Absenz der Person.
Korrespondierend mit der sachlich-nüchternen Bildsprache der Portrait-Tableaus ist auch der Ton der Texttafeln lakonisch-faktisch gehalten. Alle Dargestellten werden unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Beruf identifiziert, bei den Abwesenden wird der Grund ihres Fehlens angegeben. Auch durch diese Form der Dokumentation erzeugt Simon eine Gemeinsamkeit, eine Kollektivität der einzelnen Personen, die sie unter eine Geschichte subsumiert: Zwischen Lexikoneintrag, Abstract und Pressemeldung schwankend, liefert der Text trockene Hintergrundinformationen zu den mit römischen Ziffern betitelten Fällen, die indes alles andere als alltäglich sind und mitunter auch schon Gegenstand der weltumspannenden Sensationspresse waren. In Kapitel I etwa geht es um den indischen Landbauern Shivdutt Yadav und dessen jüngere Brüder, die von korrupten Beamten des örtlichen Grundbuchamts für tot erklärt wurden, so dass der ihnen qua Erbrecht zustehende väterliche Grundbesitz an Verwandte eines ihnen in der Erbfolge nachstehenden Familienstamms fallen konnte.
_medium.jpg)
Taryn Simon, „A Living Man Declared Dead and Other Chapters“, 2011
Installationsansicht, Neue Nationalgalerie, Berlin. Foto: David von Becker
Abgesehen davon, dass diese Geschichte dem Werk den romanhaften Titel liefert, etabliert sie auch die Blutlinie als formale Grundlage der Erzählung und wirft gleich zu Beginn die für die folgenden Kapitel wichtige Frage auf, inwieweit das Schicksal eines Familienmitgliedes das Leben seiner Angehörigen verhängnisvoll beeinflussen kann. Allerdings sind nicht alle Fälle bezüglich der kausalen Rolle, die der Rang innerhalb eines Stammbaums für jedes Individuum bedeutet, so eindeutig gelagert. Tatsächlich sind sie bei genauerem Hinsehen sogar sehr disparat. Es eint sie mehr die Familienähnlichkeit des Ungewöhnlichen als irgendeine andere Eigenschaft. Bei den ukrainischen Waisenkindern etwa, die – so der Begleittext – in Zukunft leicht Prostitution und Menschenhandel zum Opfer fallen könnten, geht es gerade um die fehlende Zugehörigkeit zu einer potentiell Schutz bietenden Familiengruppe. Aus dem Rahmen fällt auch Kapitel VI, das scheinbar ohne Ironie von 24 europäischen Kaninchen handelt, die 1859 für die Jagd in Australien ausgesetzt wurden und sich dort schnell zur Landplage entwickelten. Leider wird nicht wirklich ersichtlich, welcher Logik diese beiden Ausnahmekapitel für das formalistische Klassifikationssystem der gesamten Arbeit folgen. Selbst wenn Simon beim Beispiel der sich explosionsartig fortpflanzenden Hasen mit dem Mittel der Übertreibung arbeitet und so vielleicht darauf hinweisen will, dass die biologistische Kategorie der Blutsverwandtschaft zur Konstruktion von Identität und Zugehörigkeiten nur wenig beitragen kann, so wäre dies doch eher ein banaler Befund.
Wenn es Simon aber nicht um die Entwicklung einer universalistischen Erkenntnis geht – außer vielleicht der trivialen Einsicht, dass das Schicksal des Menschen gemacht und nicht vererbt wird – und jedes Fallbeispiel also relativ zu seinen historischen, sozio-politischen und kulturellen Bedingungen zu beurteilen ist, wird es schwer für die Künstlerin, den Vorwurf des Exotismus zu entkräften. Nur weil die Fälle ins Museum verschoben sind und gerade nicht auf die Schockwirkung der bunten Titelblätter hin inszeniert wurden, verlieren sie nicht ihre aufsehenerregende Wirkung. Im Gegenteil: Die pseudowissenschaftliche Formstrenge der Präsentation verstärkt die Ungeheuerlichkeit der verhandelten Beispiele und suggeriert in der homogen monumentalen Inszenierung eine intrinsische Kohärenz, die sie gerade nicht haben.
Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen jedes Kapitels sind die „Fußnoten-Bilder“ im Hinblick auf Form, Inhalt und Charakter weitaus heterogener, weil weniger formalisiert. Simons Aufnahmen zeigen Landschaften, Städte und Räume, in denen der betreffende Fall spielt, sowie für ihn relevante Dokumente oder Objekte, die im Textteil erwähnt werden. Einige Bilder in diesem Paneel simulieren die Beweiskraft wissenschaftlicher Belege, andere wirken rein suggestiv und dienen als assoziative Scharniere innerhalb der im Textteil skizzierten Familiengeschichten. Mit der Ästhetisierung der vermeintlich dokumentarischen Fakten sowie der Verwissenschaftlichung von rein illustrativem Material verweist Simon auch kritisch auf die fragwürdigen Beweisführungen, die im Rahmen der Ethnografie und Phrenologie des 19. Jahrhunderts zu rassistischen Zwecken mit Fotografie getrieben wurden.
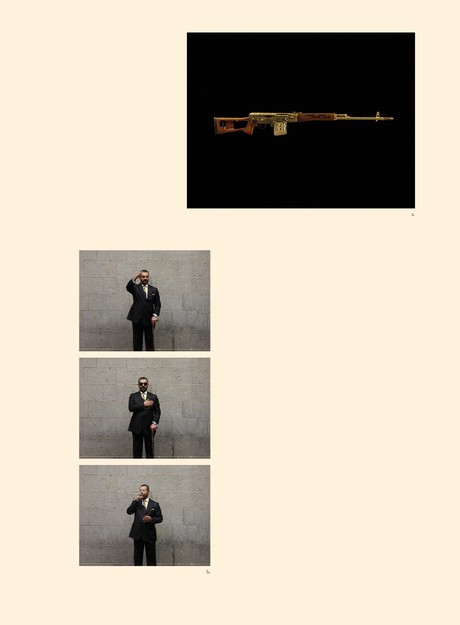
Taryn Simon, „Auszug aus Kapitel IV, A Living Man Declared Dead and Other Chapters”, 2011. Foto: David von Becker
Die Gesamtwirkung der Installation ist komplex, aber letztlich enttäuschend. Moralische Empfindungen wie Mitgefühl und Unrechtsbewusstsein werden – trotz oder vielleicht gerade wegen der undramatischen Präsentation – evoziert. Metafragen zur Bildwürdigkeit, zur Form und Funktion der Archivästhetik, zur Beschaffenheit, Relevanz und Problematik unserer Informationserfassung und Wissensbildung werden zwar implizit aufgeworfen. Gewiss, Simon beherrscht die konzeptualistische Klaviatur vorzüglich. Doch am Ende des Rundgangs kommt sich der Besucher vor wie ein kultureifriger Tourist, der im Parforceritt zu allen sieben Weltwundern geleitet wurde, ohne dabei je einen Blick hinter die Fassaden der bereisten Orte geworfen zu haben. Gerade weil die Akkumulation von 18 verschieden gelagerten Dramen nicht zu einer übergeordneten These führt, wünscht man sich im Nachhinein, dass die Künstlerin ihren Untersuchungsgegenstand „Blutslinie“ nicht in der Pluralität des Diversen behandelt, sondern klarer eingegrenzt hätte. Auch im Anschluss an frühere Arbeiten hätte womöglich die Konzentration auf eine tiefer gehende Überprüfung von Begriffen, Kriterien und Repräsentationsmitteln der für die Darstellung, Wahrnehmung und Interpretation eines ausgewählten Beispiels relevanten Faktoren ein klareres Ergebnis zu Tage gefördert.
Nun mag die Irritation oder sogar Dissoziation des Besuchers ein genau beabsichtigter Effekt von Simons Strategie sein, im Sinne des postmodernen Credos, dass nicht der Autor sich über das Chaos des vielfach überlagerten Textgewebes aus Informationsfragmenten zu erheben hat, sondern der Betrachter selbst Kohärenz schaffen und eine Haltung hierzu einnehmen soll. Nur hinterlässt diese Argumentation den schalen Beigeschmack von Effekthascherei. Warum derart haarsträubende, bizarre, blutrünstige Fälle ausbreiten und damit insinuieren, dass sich gerade von den anthropologischen Rändern aus etwas über die allgemeine conditio humana aussagen ließe, nur um dann den essentialistisch-fatalistisch aufgeblasenen Luftballon wieder platzen zu lassen und die Betrachter/innen zurückzulassen mit der banalen Einsicht, dass zu den sozio-politischen Faktoren, die unser aller Schicksal beeinflussen, letztlich doch auch die Blutsverwandtschaft gehört? Das fundamentale Problem dieser Arbeit besteht in ihrem Missverhältnis zwischen Aufwand und Erkenntnisgewinn.
Taryn Simon, „A Living Man Declared Dead and Other Chapters”, Neue Nationalgalerie, Berlin, 22. September 2011 bis 1. Januar 2012.
