Last Night von Calla Henkel & Max Pitegoff
Wenn man sich durch all die Eventfotos der ca. letzten sechs Jahre auf der Facebook-Seite von 032c klickt, findet man innerhalb der markanten Ästhetik des Berliner Kulturmagazins einen Rhythmus von Gesichtern. Typisch für den 032c-Look ist eine spezielle Form des sozialen Raums: grelles Blitzlicht und geringe Tiefenschärfe, gefüllt mit Körpern und glänzendem Haar. Die Porträtierten werfen dem Fotografen treuherzige Blicke zu, die Kamera (in der Hand von Maxime Ballesteros, aber auch anderen wie Lukas Gansterer oder Kate Bellm) ist stets nah dran, die Gesichter selten weiter als einen Meter entfernt. Die gut ausgeleuchteten Schnappschüsse, Tagging-geeignet, kultivieren Lokalprominenz, ohne besondere Inhalte zu vermitteln, außer diesem einen, entscheidenden: wer sich mit wem im Raum befand. Die Reise durch die Abende fügt sich zu einer Chronik aus orange gefütterten Bomberjacken, Schattierungen von Berliner Schwarz, durchsichtigen Mesh-Tops, zum Ausgehdress mutierter Trainingskleidung, Designs von Nhu Duong, Vetements und Gosha Rubchinskiy sowie jüngst auch punktweise eines der 032c-Sweatshirts. Die Zeit vergeht, die Räume wechseln, Menschen kommen und gehen. Was konstant bleibt, ist die Fotoästhetik, die uns die Gesichter der späten 2000er und frühen 2010er Jahre wie in Bernstein bewahrt.
Wenn man aus Stößen von Bilderalben einen Abend rekonstruiert, wie das auf Facebook üblich ist, kommt schwermütige Nostalgie auf. Die Fotos der 032c-Partys wie auch jene ähnlicher Publikationen – Purple.fr oder ältere, mehr hochgestylte Versionen wie Cobrasnake aus Los Angeles oder LastNightsParty aus New York – konservieren etwas, was heute veraltet wirkt. Dies liegt sicher an dem Wandel, den sowohl die Mode- als auch die Foto-Netzwerke im letzten Jahrzehnt durchlaufen haben. Gemeint ist das Bedürfnis, eine Persönlichkeit, einen „Kreativen“, ja, sogar ein Kleidungsstück zu dokumentieren, effektiv zu taggen und als Teil der Repräsentation eines spezifischen gesellschaftlichen Milieus medial weiterzuverbreiten. Die Anfänge dieses nach Markenprinzipien strukturierten sozialen Geotargeting werden generell auf die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts zurückgeführt (als die zugrunde liegenden Social-Media-Plattformen verfügbar wurden). Ausschlaggebend für dieses Modell war der Verzögerungsfaktor: #lastnightsparty fand mindestens letzte Nacht statt, wenn nicht gar ein paar Nächte früher. In jedem Fall handelte es sich um eine einzige, ganz spezielle Party, deren Dokumentation zu einem Fotokonvolut mit einem klaren visuellen Konzept zusammengeschweißt wurde. Obwohl das Bildformat dem Web-2.0-Standard entsprach, hatte die Zeitverzögerung etwas von der guten alten Analogfotografie, wo sich die Erinnerung noch in Stapeln von Papierfotos ausleben durfte – oder noch besser von Polaroids, die (fast) sofortige Belohnung von Präsenz vor Zeiten des Internets.
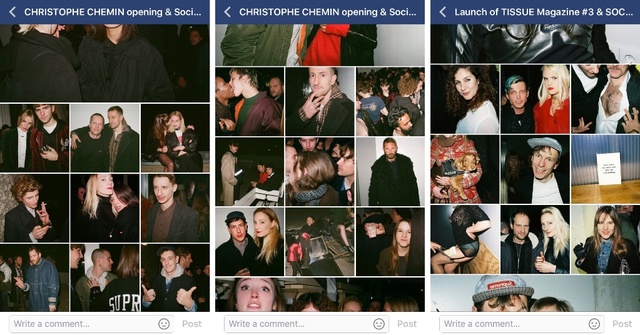 Partyfotos von Maxime Ballesteros für 032c (via Facebook), 2016, Screenshot
Partyfotos von Maxime Ballesteros für 032c (via Facebook), 2016, Screenshot
Nächtlich auf Instagram verirrt man sich stattdessen im Nebel der Echtzeit. Entweder werden zu viel Inhalte gepostet oder zu wenig. Da niemand da ist, dem Ganzen einen einheitlichen Auftritt zu verpassen, kommt praktisch nie echte Nostalgie, echte FOMO auf. Diese Live-Bild-abstraktion hat die kalkuliert stilisierten, willkürlich unwillkürlichen Nachbilder einer Nacht à la 032c abgelöst. Anstelle einer Kollektion ausgewählter Polaroids ist die letzte Nacht – oder richtiger, die heutige Nacht, jetzt – zu einem einzigen ästhetischen Schmierer geworden: Die Dokumentation des Nachtlebens gerät immer mehr zum leicht schäbigen kollektiven Bemühen, dessen Produkte irrelevant werden, sobald man sie einmal gesehen hat. Jeder ist sein eigenes Model und spielt mit dem Fotostream Jenga.
Diese Art der Bildvernebelung ist besonders kompatibel mit dem Berliner Ethos des Bildverbots – zum Schutz der Nacht und der in ihr florierenden Subkulturen. Ein Beispiel dafür sind die Sticker, mit denen Besuchern des Berghain die Handykameras zugeklebt werden. Wer trotzdem fotografiert, erhält abstrakt-monochrome Fotos, die dann als Beweis, dass man es geschafft hat, hineinzukommen, unter dem Hashtag #berghainsticker auf Instagram gepostet werden. Die Abstraktion überlässt es dem Empfänger, sich auszumalen, was im Club passiert. Bildverbot bedeutet auch Bildkontrolle, eine Markenstrategie, die effektiver ist als die (fraglos mindestens ebenso regulierte) Ikonografie der Partyfotografie. Auch im Berliner Soho House, 2010 eröffnet, herrscht Fotografierverbot. In der Theorie sollen dadurch die Promis, die dort ein und aus gehen, geschützt werden, wie auch die zahlreichen Künstler, deren Kunstwerke dort – eingetauscht gegen eine Mitgliedschaft – nun hängen. Wie im Berghain abstrahiert das im Soho House geltende Fotografierverbot, was drinnen abläuft; ein Beweis ex negativo, dass die sich in den Räumlichkeiten befindlichen Personen und Objekte so besonders sind, dass sie geschützt werden müssen, geschützt vor Zirkulation, geschützt vor Profitzwecken. Schutz besteht auch dort, wo Ausnahmen gewährt werden: Vor ein paar Wochen wurde Wolfgang Tillmans (dessen Fotoarbeiten in der Panorama Bar des Berghains hängen) mit Kamera in den Club gelassen – eine ausgesprochene Rarität. Solche Beschränkungen stellen sicher, dass es sich bei jenen Bildern, die tatsächlich in die Außenwelt sickern, nicht bloß um schlechte iPhone-Fotos der Klokabinen handelt – sondern um Tillmans-Fotografien, die sowohl größeren Wert besitzen als auch besser ein gewünschtes Image pflegen, existieren sie doch zugleich innerhalb und außerhalb der Mode.
In seinem Text „Party Photo Value“, erschienen in Les Cahiers Purple (einer Schwesterzeitschrift von Olivier Zahms Purple Fashion), meint Antek Walczak, die für New York um 2010 prototypische Variante dieses Fotogenres in einem JPEG auf einer Condé-Nast-Website gefunden zu haben, auf der, wie er schreibt, die abgelichteten It-Girls eine Ikonografie der Ambitionen in Szene setzen. Ein halbes Jahrzehnt und mehrere neue Fotoplattformen später können wir beginnen, die Halbwertzeit solch ambitionierter JPEGS zu messen. Dabei stellt sich die Frage: Wie haben sich die Ambitionen verändert?
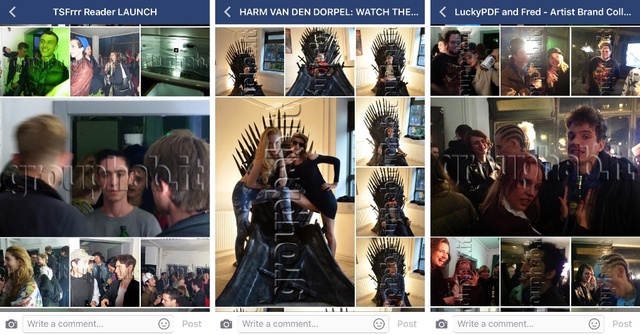 Partyfotos von Julia Burlingham für grouphab.it (via Facebook), 2016, Screenshot
Partyfotos von Julia Burlingham für grouphab.it (via Facebook), 2016, Screenshot
Als Übergangsform bietet sich grouphab.it an, der kurzlebige Berliner Projektraum, der 2012 auf- und wieder zusperrte (stark vom Berliner Post-Internet-Moment geprägt). Zu einer Zeit, als Facebook-Alben als (gerade noch) respektables Format für die Dokumentation von Kunstausstellungen galten, veröffentlichte grouphab.it alle seine Dokumentationen exklusiv über das soziale Netzwerk. Noch ehe Instagram den Takt anzugeben begann, unterlief, ja, demontierte grouphab.it die Logik der 032c-Ästhetik durch Postings, die hoffnungslos überladen mit Vernissagefotos waren und mit fortschreitender Nacht zunehmend außer Form gerieten. Die meist dunklen und verschwommenen Aufnahmen der Fotografin Julia Burlingham zeigten Gäste in albernen Posen, Bierflasche in der Hand, vor den nur schwer auszumachenden Kunstwerken. Jeder Upload in die narrativen Höhlen von Facebook wurde mit einem absurd großen Wasserzeichen abgestempelt. Die zweite Ausstellung des Hauses, „Watch the Throne“ von Harm van den Dorpel, nahm schon im Konzept eine solche mediale Verbreitung vorweg. Der Künstler stellte eine Nachbildung des aus Schwertern zusammengeschweißten, überladenen Goth-Throns aus „Game of Thrones“ in den Raum. Fast wie der Weihnachtsmann im Warenhaus diente die Skulptur effektiv als Requisit für den Fototermin, die Opening-Gäste posierten, und die Schnappschüsse verloren zunehmend an Schärfe. Der Projektraum hielt sich nur ein paar Monate, und auch das Bildmaterial hatte einen gewissen Wegwerfcharakter. Doch dank dem langen Gedächtnis der Tags kommen sie immer wieder zum Vorschein, einbalsamiert in Facebook-Alben.
In all diesen besprochenen Bildkategorien gibt es einen Bezug zum Abfall oder besser zu Dingen, die weggeworfen werden, sei es nun Geld, Zeit, die wir im Suff verplempern, durch Zigarettenrauch versiffte Designerklamotten, oder seien es auch nur unser eigenes Abbild und unsere Privatsphäre, die wir mit willigem Lächeln verschenken. Immer mehr Dienste scheinen sich dieser Erkenntnis anzuschließen, etwa Snapchat, wo gepostete Bilder schon nach ein paar Sekunden wieder verschwinden. Vielleicht ist das der Punkt, wo sich die Ambitionen verändert haben und wo die Plattformen jetzt die Zügel straffer ziehen. Instagram droht damit, den bislang kollektiven, chronologischen Stream einem Algorithmus zu unterwerfen, der Bilder nach Popularität reiht und ihn dadurch einer Hierarchie der Markenlogik angleicht. Das ist einerseits Produktion von Wert und andererseits Reduktion von Abfall, das heißt von all dem, was unbeliebt, überschüssig, unserer Aufmerksamkeit unwürdig oder schlicht suboptimal ist. Petra Cortright nannte das Clickbait-artig „die Gentrifizierung des Internets“.
 Stockfoto auf EyeEm
Stockfoto auf EyeEm
Dazu passt der Berliner Fotodienst EyeEm, der als eine Art Instagram bei Tageslicht auftritt und das Soziale auf die Privatbeziehung zwischen Fotograf und Welt reduziert. Die Website von EyeEm strotzt von Bildern robuster Freiluft-aktivitäten und von Panoramen mit einsamen Einzelfiguren in einer Stilmelange aus Caspar David Friedrich und Ryan McGinley. EyeEm verkauft sich als Instagram für Profis, und durch einen Partnervertrag mit Getty Images soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass eingereichte Fotos kommerzielle Verwendung finden: Lizenzgebühren beginnen bei 20 $ und reichen bis 250 $ für die erweiterte Version. Im Prinzip erzeugt EyeEm eine Bild-Feedbackschleife: eine, in der Marken wie AirBnB oder Uber Bilder benötigen, die so schnelllebig sind wie ihre Kunden. Doch in dem Geschäftsmodell steckt, wie ein Mitarbeiter des Dienstes zugab, ein Paradox. Denn wie kann EyeEm konstant interessante Bilder anbieten, wenn die Nutzer genau wissen, dass banale, ja fast abstrakte Bilder sich am besten verkaufen: strahlend blauer Himmel, Füße im Sand, ein verschwommener Hund im hohen Gras? Die Millenial-freundlichen Firmen wollen monochrome Bilder, also #berghainsticker, die gerade genug Raum für die Fantasie der Marke lassen. Und da EyeEm noch keinen Algorithmus erfunden hat, der Material mit Getty-Niveau automatisch auswählt, müssen nach wie vor die Augen Berliner Angestellter bestimmen, welche der Fotos unter Tausenden täglichen Einsendungen cool und offen und assoziativ genug sind.
Der EyeEm-Stream harmloser, gefühlsleerer Bilder, in denen Bedeutung vorgeblich den hochgesättigten Farbtönen entströmt, lässt keine Nostalgie zu, die über den aktuellen Stand der Technik hinausgeht – das heißt über die Filter und Kurven, die einen visuellen Moment anno 2016 ins Auge springen lassen. Der Werthorizont des EyeEm-Angebots ist weit. Seine nichtssagende Allerweltsbotschaft bildet einen scharfen Kontrast zur Enge der 032c-Alben, wo Bedeutung aus kuriosen Details herausgelesen wird: Reißverschlüsse, Bierflaschen, räumliche Nähe, aus dem Tagging ausgewählter Gäste im Feedbackloop von der Party zur Plattform, wo die Logik der Mikro-Celebrity performt wird. In diesem Loop, in der haltlosen Freude an den Ambitionen einer Millisekunde, die dazu bestimmt sind, allzu bald ins Facebook-Grab zu sinken, liegt Ehrlichkeit; es gibt hier keinen Fluchtweg, keine in den Sonnenuntergang gewandte Silhouette, nur die Realität der Performance im Kamerablitz.
Übersetzung: Bernhard Geyer
Anmerkungen
| [1] | Partyfotos von Maxime Ballesteros für 032c (via 032c.com), 2016, Screenshot |

