Das falsche Buch zur richtigen Zeit Floris Biskamp über „Beißreflexe“ von Patsy l’Amour laLove
 „Boys Don‘t Cry“ (Regie: Kimberly Peirce), 1999, Filmstill
„Boys Don‘t Cry“ (Regie: Kimberly Peirce), 1999, Filmstill
Für den amerikanischen Kunsthistoriker und Aids-Aktivisten Douglas Crimp kam „Queer“ bekanntlich vor „Gay“ und ist als Selbstbezeichnung auch deswegen vorzuziehen, weil der Begriff nicht wiederum normalisierend funktioniert. Queer ist abweichend und sogar störend. Die derzeit viel diskutierte Aufsatzsammlung „Beißreflexe“ (2016) behauptet jetzt, dass dieses Stören inzwischen zum Selbstzweck geworden ist. Der Vorwurf des Buches lautet, dass sich Queeraktivismus zunehmend um Sprechverbote drehe und weitgehend unfähig sei, eine differenzierte Auseinandersetzung zu führen.
Im Zuge der Debatte, die in den letzten Wochen und Monaten in verschiedenen Medien („Zeit“, „Missy Magazine“, „Emma“) um diese Publikation entbrannte, haben sich sowohl die „Beißreflexe“-Autoren und -Autorinnen als auch Judith Butler, Sabine Hark, Paula-Irene Villa, Alice Schwarzer und andere zu Wort gemeldet. Der Politikwissenschaftler Floris Biskamp geht im Folgenden der Frage nach, was an der Diagnose von „Beißreflexe“ dran ist.
Wenn es zur rechten Zeit erscheint, kann auch ein relativ kleines Buch relativ große Wellen schlagen – und das hat der von Patsy l’Amour laLove herausgegebene Sammelband „Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten“ ganz ohne Zweifel. Wie weit die Wellen tragen, die die Veröffentlichung dieser Abrechnung mit Queerfeminismus, Intersektionalität und Gender Studies im Berliner Querverlag ausgelöst hat, wurde zuletzt durch einen öffentlichen Schlagabtausch feministischer Größen deutlich. Nachdem Alice Schwarzers EMMA einigen Autoren und Autorinnen des Sammelbandes Raum gab, ihre Thesen im Rahmen eines Dossiers noch einmal zuzuspitzen, fühlte sich Judith Butler selbst dazu bemüßigt, in der Zeit eine gemeinsam mit Sabine Hark verfasste Replik zu veröffentlichen – eine erneute Antwort von Alice Schwarzer an gleicher Stelle folgte eine Woche später.
Derartige Reaktionen konnte „Beißreflexe“ provozieren, weil der Band einen relativ blank liegenden Nerv getroffen hat, nämlich den Nerv eines weit verbreiteten Unbehagens an queerer und antirassistischer Kritik. Dieses Unbehagen ist genauso zwiespältig wie „Beißreflexe“ selbst, denn für die Kritisierten kann queere Kritik sowohl in ihren besten und treffendsten als auch in ihren schlechtesten und ungerechtesten Momenten unbehaglich sein und stören, bis die Nerven blank liegen.
Queere Kritik ist immer auch ein Knüppel, den fortschrittliche oder linke Bewegungen sich selbst oder einander wechselseitig in die Beine werfen – und das ist gut so. Nicht zufällig entwickelte sie sich nicht direkt als Kritik der herrschenden Geschlechterordnung, sondern als Selbstkritik der feministischen Kritik an dieser Ordnung. Das klassische Beispiel hierfür ist das als eines der Gründungsdokumente der Queer Theory geltende Buch „Das Unbehagen der Geschlechter“. In ihm formuliert Judith Butler ihre eigenen Thesen als eine Kritik feministischer Theorie und zeigt, wie noch die avanciertesten Theorien die Setzung einer fraglos gegebenen Zweigeschlechtlichkeit relativ unkritisch reproduzieren und so zur Fortschreibung der Zwänge, Ausschlüsse und Marginalisierungen beitragen, die diese Zweigeschlechtlichkeit mit sich bringt, insbesondere für die, die nicht darin aufgehen. Mit solchen Argumenten schließt queere Kritik an Jahrzehnte feministischer Selbstkritik an, in der „die Frau“ als einheitliches Subjekt des Feminismus immer weiter infrage gestellt wurde. Damit wurde sie auch zu einer naheliegenden intersektionalen Bündnispartnerin für antirassistische Kritik und postkolonialen Feminismus, die schon lange problematisieren, dass die wirklichen Interessen nichtweißer, nichtwestlicher Frauen in feministischen Kämpfen für „die Rechte der Frau“ oft unberücksichtigt bleiben.
Die Praxis queerer Kritik besteht dementsprechend zumeist darin, Personen, die sich selbst als feministisch, herrschaftskritisch, progressiv, links oder liberal verstehen, damit zu konfrontieren, dass sie selbst Herrschaft und Ausschlüsse reproduzieren. Solche Kritik kann, nicht nur für diejenigen die in der herrschenden Geschlechterordnung unsichtbar und marginalisiert sind, ermächtigend, befreiend, erhellend und lustvoll sein. Für die Kritisierten ist sie aber regelmäßig frustrierend – und sie ist es gerade dann, wenn sie trifft. Wenn queere Kritik den Kritisierten nicht manchmal Unbehagen bereitete, könnte sie auch keine Veränderung bewirken. Jedoch löst das frustrierende Unbehagen bei vielen den Impuls aus, sich für diese Kritik gerade nicht zu öffnen, sondern sie abzuwehren: Man meint es doch gut, hat es eh schon schwer und engagiert sich, dann will man sich nicht auch noch damit auseinander setzen müssen! Indem „Beißreflexe“ queere Kritik als reaktionär und autoritär abqualifiziert, bietet das Buch allen, die diesen Impuls verspüren, eine langersehnte Ausrede, sich queerer Kritik zu verschließen: Komm’ mir jetzt nicht mit queer! Hast du nicht ,Beißreflexe‘ gelesen? Die spinnen doch eh alle!
Jedoch wäre es allzu bequem, den von „Beißreflexe“ getroffenen Nerv allein auf diesen Drang zur Abwehr von im besten Sinne störender Kritik zu reduzieren. Ist queere Kritik schon in ihren besten Momenten unbehaglich, gilt dies umso mehr in Momenten ihres Exzesses. Solche Exzesse gibt es in verschiedenen Formen. In einigen Fällen wird Kritik an gewaltvoller und diskriminierender Sprache zu einem autoritär überwachten Ausweis von Gut und Böse – und verwandelt sich somit von einer politischen Intervention in eine moralische Ordnung. In anderen Fällen wird die Positioniertheit oder Identität der Sprechenden nicht nur reflektiert, um falsche Universalisierungen von partikularen (weißen, Hetero-, Cis-) Positionen zu vermeiden, sondern direkt zum alleinigen Kriterium für die Gültigkeit des Gesagten erhoben – Paula-Irene Villa spricht in diesem Zusammenhang treffend von einem „positionalen Fundamentalismus“. In wieder anderen Fällen wird Geschlecht in grober Fehlinterpretation queerer Theorie nicht als ein kaum entrinnbares Zwangssystem, das sich nur mit Mühe unterlaufen lässt, verstanden, sondern als lustiges Spiel, bei dem alle alles sein können. In einigen Teilen der Szene „übertrumpft“ antirassistische Kritik feministische, sodass patriarchalische Gewalt außerhalb westlicher Kontexte unbenennbar wird. In Extremfällen wie bei der Theoretikerin Jasbir Puar schließlich führt die Suche nach devianten Positionen, die sich als queeres Anderes gegen die herrschende Ordnung ausspielen lassen, in schlechter antiimperialistischer Tradition bis hin zur positiven Bezugnahme auf reaktionärste islamistische Bewegungen.
Diese in „Beißreflexe“ benannten Probleme existieren, und zwar nicht als isolierte Einzelfälle, sondern als reale Tendenz, die destruktiv wirkt, weil sie zu Ungerechtigkeiten und Ausschlüssen führt, Debatten abwürgt, Menschen frustriert und sie von Aktivismus abschreckt. Die Exzesse sind zumindest als Möglichkeit in den Grund-annahmen und Lücken queerer Theorie und Praxis angelegt. Weil sich queere und rassismuskritische Positionen vor allem in linken Kontexten zunehmend etablieren, wurden fast alle, die sich in den letzten Jahren dort bewegen, schon mit ihren exzessiven Formen konfrontiert. Die berechtigte Frustration, die sich aus diesen im schlechten Sinne störenden Seiten queerer Kritik ergibt, ist die zweite Quelle des Unbehagens, auf dem der Erfolg des Buches beruht. Dass diese Exzesse thematisiert werden, ist zu begrüßen; die Art, auf die dies in „Beißreflexe“ geschieht, ist es jedoch nicht.
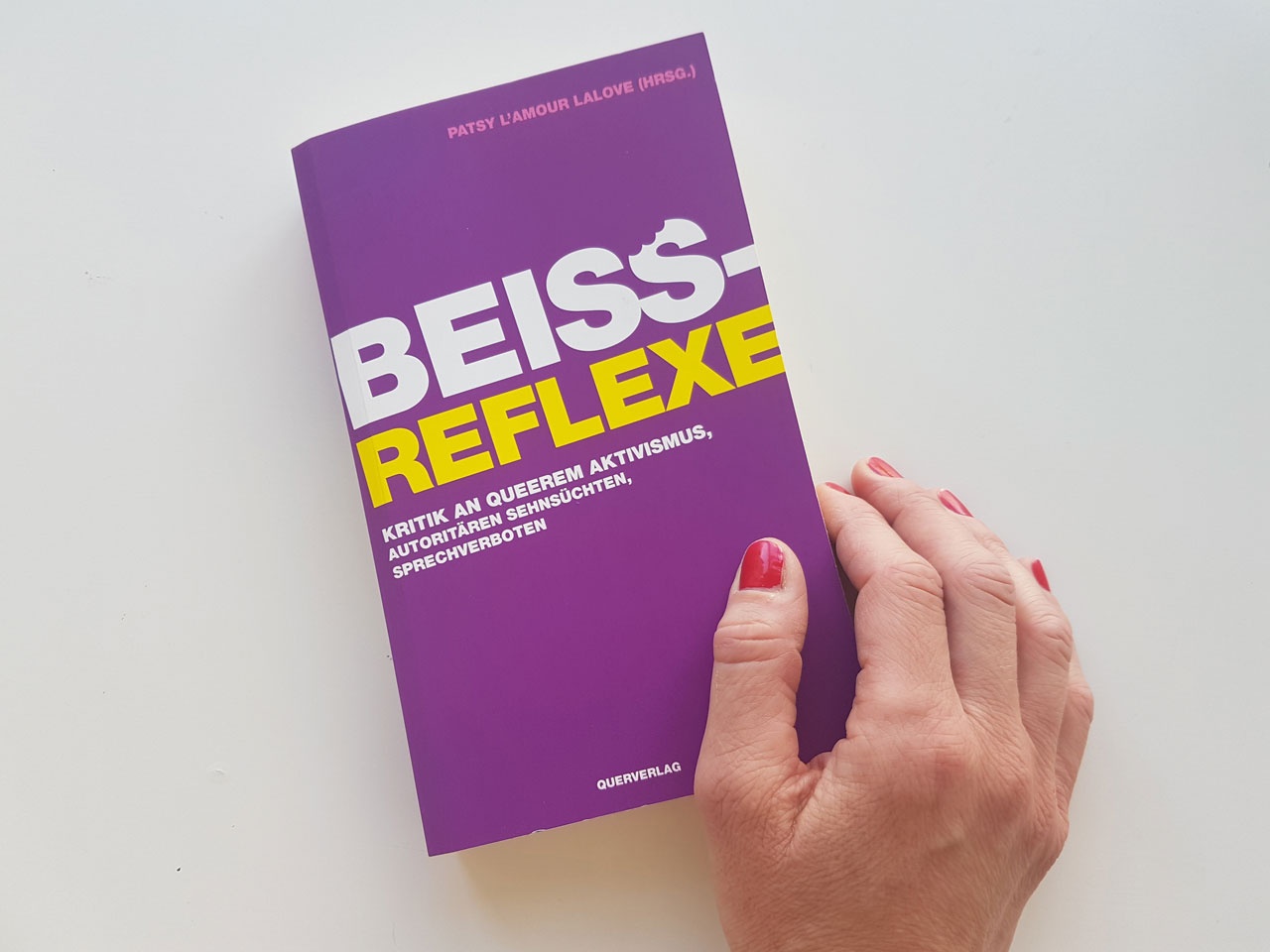
Das Hauptproblem des Buches besteht darin, dass die Exzesse queerer Kritik gerade nicht als Exzesse thematisiert werden, die auch innerhalb queerfeministischer Kontexte zu Konflikten führen und Gegenstand von Kritik sind. Stattdessen konstruiert das Buch den homogenen Gegenstand „Queeraktivismus“, identifiziert ihn als Ganzes mit dem Exzess und bläst das Problem dadurch in karikaturhafter Manier zu einer regelrechten Gefahr für uns alle auf. Auch wenn sich die Beiträge im Schärfegrad unterscheiden, ist -„Beißreflexe“ insgesamt ein polemisches Unterfangen. Eine ernsthafte kritische Würdigung dessen, was queere und antirassistische Kritik leistet, fehlt völlig, von explizit queerfeministischen Gegenpositionen ganz zu schweigen. Eben daher eignet sich das Buch so hervorragend als Grundlage für die pauschalisierende Abwehr von queerer Kritik, aber kaum als Anstoß für eine Reflexion und produktive Debatte über ihre potenziellen Exzesse.
Es mag sein, dass es, um einen Nerv zu treffen, manchmal nicht reicht, zur richtigen Zeit die richtige Stelle anzuvisieren. Wenn er wahrgenommen werden und eine Debatte provozieren soll, muss der Treffer mitunter auch mit einiger polemischer Härte erfolgen. In „Beißreflexe“ wird die Polemik jedoch in einer Weise zugespitzt, die eine produktive Debatte fast unmöglich macht. Wer die Gegenüber zu psychisch kranken und defizitären, bösartigen und machthungrigen (Nicht-)Subjekten herabwürdigt, wie es einige der am Sammelband Beteiligten tun – zu nennen wären neben den Beiträgen der Herausgeberin die von Caroline A. Sosat, Koschka Linkerhand, Jakob Hayner und Till Randolf Amelung –, kann nicht erwarten, dass die dabei vorgebrachten Kritikpunkte in der Sache ernsthaft angenommen und reflektiert werden. Dies gilt umso mehr, als die so Angegriffenen derartige Attacken seit Jahren aus verschiedenen Richtungen ertragen müssen und sich dementsprechend selbst im Abwehrmodus befinden. Deshalb ist „Beißreflexe“ gerade nicht das „Angebot zur Reflexion“, als das es im Einleitungsessay von Patsy l’Amour laLove angepriesen wird. Es kommt zur richtigen Zeit, ist jedoch nicht das richtige Buch.
Aber wie könnte eine produktivere Debatte aussehen? Vor dem Hintergrund bestehender Machtgefälle und der verbalen Gewalt, die sowohl im Buch gegen queere Aktivisten und Aktivistinnen als auch im Nachgang in den sozialen Medien insbesondere gegen die Herausgeberin ausgeübt wurde, mag dieser Vorschlag hilflos, naiv, banal und vielleicht sogar arrogant wirken, aber wenn man tatsächlich eine offene Debatte führen und zu einer besseren kritischen Praxis kommen will, wäre dies nur auf Grundlage einiger ethischer Mindeststandards möglich. Zunächst wären den Gegenübern gute Absichten und Rationalität zu unterstellen. Es wäre ihnen zu unterstellen, dass sie ebenso wie man selbst darauf zielen, Herrschaft, Ausbeutung, Marginalisierung und Unsichtbarkeit zu kritisieren, um sie aus der Welt zu schaffen. Es wäre ihnen zu unterstellen, dass ihre Verfehlungen in der Regel Verfehlungen und nicht etwa Bösartigkeiten sind. Vor sich selbst dagegen müsste man eingestehen, dass auch bei den besten Absichten das eigene Denken ignorant und die eigene Praxis falsch sein könnten und man sich daher auch gegenüber störender Kritik lernbereit zeigen sollte. Wir müssen uns eingestehen, dass wir dabei ständig versagen. Am wichtigsten wäre es schließlich, anzuerkennen, dass Differenzen nicht immer Differenzen zwischen gut und böse, falsch und richtig, progressiv und regressiv, emanzipatorisch und reaktionär sind, sondern manchmal einfach irreduzible Interessenkonflikte, mit denen man bestenfalls auf eine für alle Seiten erträgliche Weise umgehen sollte, die man aber nicht in Wohlgefallen auflösen kann.
Patsy l’Amour laLove (Hg.), „Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten“, Berlin: Querverlag, 2017.
