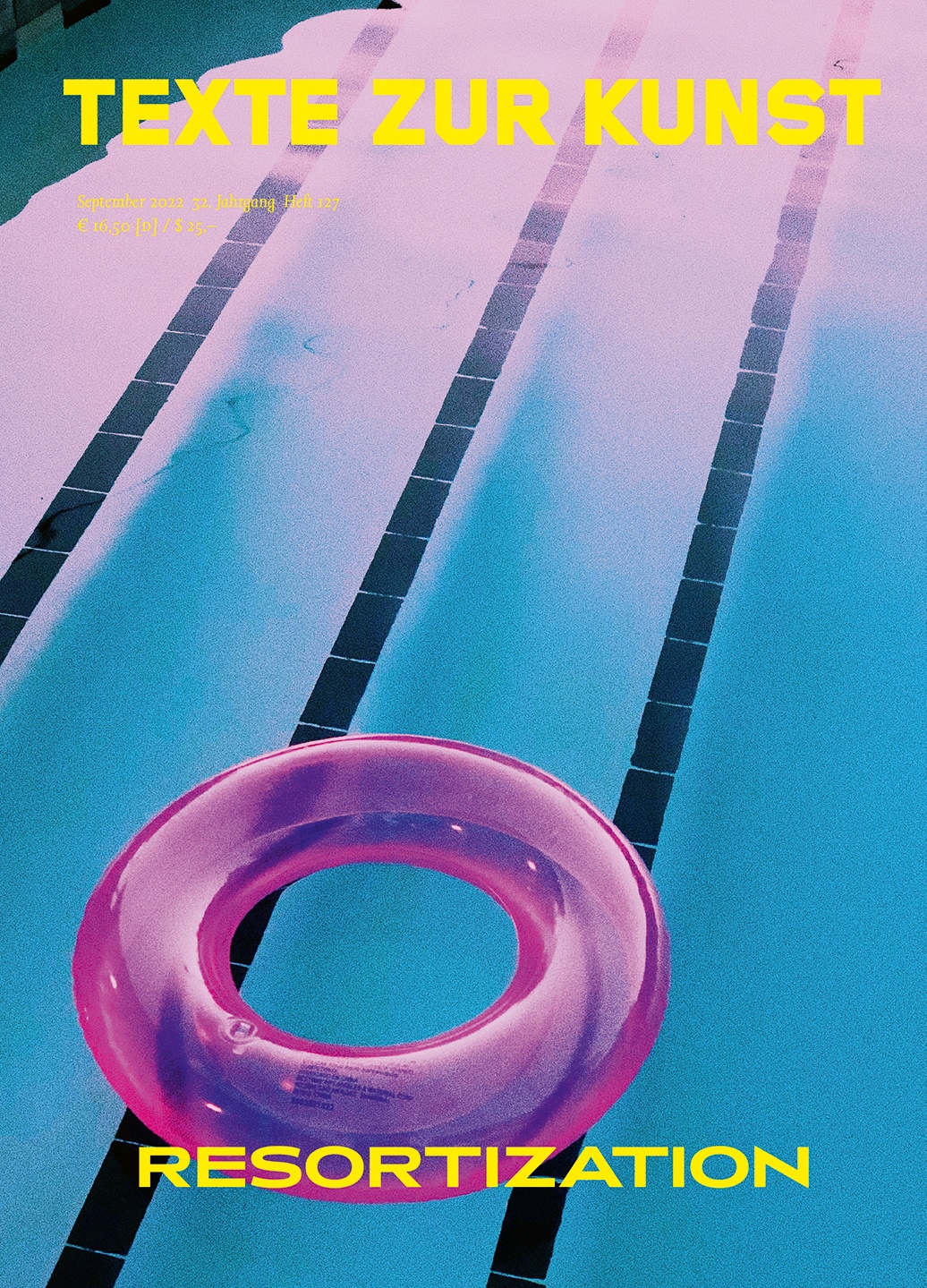Die Beobachtung, dass immer mehr Kunstkritiker*innen vor negativen Beurteilungen zurückschrecken, motivierte uns bereits 2002 zu einer Ausgabe über Verrisse. Seither haben sich die Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb des eng vernetzten und zugleich stark segmentierten künstlerischen Feldes intensiviert. Wie der Rückgang an Rezensionen und der Personalabbau in den Feuilletonredaktionen zeigen, ist die Kritik im gesamten Kulturbereich geschwächt, in den sozialen Medien wird mitunter sogar offen gegen Kritiker*innen gewettert. So bezeichnete der Influencer Rezo kürzlich eine Musikkritikerin der „Zeit“ als „Opfer“, weil sie sich länger als fünf Minuten mit einem Album beschäftige, das sie misslungen fand. Warum Kritik gerade heute gestärkt werden muss, da sowohl demokratische Strukturen als auch kritische Stimmen in die Defensive geraten sind, erläutert Isabelle Graw hier auf Basis ihrer Analyse eines Systemwandels der Kunstökonomie.
THESE 1: KUNSTKRITIK OSZILLIERT ZWISCHEN GESCHWÄCHTHEIT UND BESTÄNDIGKEIT.
Die Frage, wie es um die Kunstkritik steht, wurde in den letzten 35 Jahren – also seit der Gründung dieser Zeitschrift – immer wieder erörtert. Zumeist wurde ihr Niedergang konstatiert; zuletzt von Benjamin Buchloh, der im Gespräch mit Hal Foster das Ende der „Critics“ zugunsten von Agent*innen mit Marktexpertise behauptete. Derartige Abgesänge scheinen mir immer dann Konjunktur zu haben, wenn die Kunstökonomie insgesamt einen „Reset“ durchläuft. Auch im Kontext des derzeitigen „Abwärtstrends des Kunstmarkts“ mehren sich Stimmen, die in finalistischer Manier das endgültige Aus für die unabhängigen Kunstkritiker*innen verkünden. Zwar spricht einiges dafür, dass die Kunstkritik in den letzten Jahren in die Defensive geraten ist – vor allem in der kommerziellen Sphäre –, zugleich gibt es aber auch etliche Anzeichen für ihr Fortbestehen, against all odds. Allein die langjährige Existenz dieser Zeitschrift kann als Beleg dafür gelten, dass eine theoretisch ambitioniert argumentierende Kunstkritik immer noch auf Interesse stößt.
Die Kunstkritik ist somit beides: geschwächt und beständig. Womöglich prädestiniert ihre aktuelle Geschwächtheit sie sogar dafür, den im Folgenden dargestellten Prozess ihrer Marginalisierung und damit die ökonomischen Veränderungen im künstlerischen Feld besonders scharfsichtig zu analysieren. Denn sie ist ja eine Art „teilnehmende Beobachterin“, die ihre eigene Marktsituation durchaus selbstkritisch in den Blick nehmen kann. Statt also einmal mehr in „Gesten der Selbstverwerfung“ zu verfallen, die konstitutiv für die Kunstkritik sind, werde ich in diesem Text die Krise der Kritik vor dem Hintergrund einer veränderten Kunstökonomie beleuchten.
THESE 2: ES GIBT ZAHLREICHE KRISENSYMPTOME, ABER AUCH HANDLUNGSOPTIONEN.
Von der derzeitigen Geschwächtheit der Kunstkritik zeugt zum Beispiel die Nachricht, dass sich die New York Times von vier ihrer bewährtesten Kunst- und Kulturkritiker*innen getrennt hat. Eine vergleichbare Entwicklung lässt sich im deutschen Feuilleton beobachten – auch hier werden die Posten scheidender Kritiker*innen oft nicht nachbesetzt, was einen Bedeutungsverlust der Kritik signalisiert. Dazu passt, dass an die Stelle von Rezensionen – dem zentralen Beurteilungsformat der Kritik – vermehrt Interviews mit Personalities abgedruckt werden, als könnten die Künstler*innen ihre „Produkte“ selbst am besten erklären. Der Raum für die kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen Arbeiten schwindet sogar in den Kunstzeitschriften, die inzwischen häufig PR-Texte im Tausch gegen Anzeigen publizieren. Die Kritik mutiert an dieser Stelle zum affirmativen Pressetext. Erschwerend kommt hinzu, dass die Unabhängigkeit der Kritik gefährdet ist: Wenn Kunstzeitschriften wie Artforum von großen Medienkonzernen aufgekauft werden, ist ihre institutionelle Unabhängigkeit nicht länger gegeben. Zahlreiche Kunstkritiker*innen (mich eingeschlossen) schreiben inzwischen auch für die hauseigenen Magazine von Großgalerien wie Hauser & Wirth (Ursula) oder Gagosian (Gagosian Quarterly), in denen zwar keine kritischen Einwände gegen die von diesen vertretenen Künstler*innen publiziert werden – dafür bezahlen sie ihre Autor*innen wenigstens gut. Da diese Galerien häufig Ausstellungen in Museumsqualität präsentieren – dieses Frühjahr gab es bei Gagosian New York eine fantastische Pablo-Picasso-Ausstellung und bei Hauser & Wirth eine großartige Francis-Picabia-Ausstellung zu sehen –, wird es auch kunsthistorisch interessanter, für diese Auftraggeber*innen zu schreiben; denn deren aufwendig gestaltete Kataloge erlauben es, das Gezeigte akribisch aufzuarbeiten. Aber auch diese Kataloge sind natürlich keine Orte unabhängiger Kritik. Die Marginalisierung der Kunstkritik vollzog sich auf der letzten Art Basel Paris auch in räumlicher Hinsicht: Am Rande des Messegeschehens traf man auf winzige Stände von wenigen Kunstzeitschriften. Kaum jemand verirrte sich dorthin.
Versteht man unter Kritik die Herausbildung von situierten, differenzierten und begründeten Werturteilen, dann ist sie auch in der Onlinesphäre auf dem Rückzug. Teile des Vertriebssystems der Kunstwelt wurden von der Tech-Industrie gekapert, sodass viele ihrer sozialen Interaktionen inzwischen auf Instagram stattfinden. Und hier regieren bekanntlich keine qualitativen, sondern quantitative Kriterien: Die Anzahl der Follower oder Likes entscheidet über die vermeintliche Relevanz einer künstlerischen Praxis. Das Problem ist zudem, dass die Auktionspreise von Kunstwerken auf Plattformen wie artnet online sofort abrufbar sind – ihr Marktwert ist also kein Geheimnis mehr und dient als Richtschnur, an der sich zahlreiche Sammler*innen orientieren. Kaum ein*e Kunstkäufer*in würde heute einen kunstkritischen Text konsultieren, bevor er*sie eine künstlerische Arbeit ersteigert. Als Gradmesser künstlerischer Relevanz dient stattdessen der Preis.
Auch in formaler Hinsicht steht die Kritik im Internet unter Druck. Das ständige Scrollen verkürzt die Aufmerksamkeitsspanne der Leser*innen, was die Lektüre längerer kunstkritischer Essays oder Ausstellungsbesprechungen erschwert. Rezipiert werden online eher andere Formate wie Podcasts oder kurze Reels von Influencer*innen.
Zwar mag der oberflächliche Blick auf die Onlinesphäre zum gegenteiligen Befund einer keineswegs geschwächten, sondern omnipräsenten Kritik verleiten – schließlich sind die sozialen Medien voll von kritischen Meinungsbekundungen. Doch ist eine persönliche Meinung eben etwas anderes als eine Kritik, zumal sich letztere im Idealfall um argumentative Nachweise und Begründungen bemüht. Dass die Kritik ebenso in die Defensive geraten ist wie die demokratische Ordnung, auf der sie fußt, lässt sich derzeit in den USA beobachten. In dem Maße, wie dort demokratische Verhältnisse abgebaut werden, wird die Kritik zum Schweigen gebracht. Kritiker*innen der Trump-Administration müssen inzwischen mit Repressalien rechnen. Zwar ist es selbstredend weniger gefährlich, eine künstlerische Position zu kritisieren, als einen autokratischen Präsidenten. Aber auch die Kunstkritik setzt demokratische Verhältnisse voraus. Somit impliziert jede Verteidigung der Kritik eine Verteidigung der Demokratie.
THESE 3: DER WUNSCH NACH KONTROVERSE IST DEM NACH ÜBEREINSTIMMUNG GEWICHEN.
Um die aktuelle Lage der Kunstkritik besser zu verstehen, hilft ein Blick auf die 1990er Jahre. Meiner Erinnerung nach waren damals sowohl die Künstler*innen als auch die Galerist*innen extrem an einer kritischen Auseinandersetzung interessiert. Erstere legten es förmlich darauf an, dass ihre Praxis kontrovers diskutiert würde – erst dadurch gewann sie aus ihrer Sicht an Bedeutung. Inzwischen hat sich die Situation jedoch vollkommen gedreht. Die meisten Akteur*innen des künstlerischen Feldes sehnen sich nach Zuspruch und Übereinstimmung, wie man zum Beispiel auf Symposien beobachten kann. Wurden die Beiträge früher kritisch auseinandergenommen, ist heute Zustimmung die Regel. Vor dem Hintergrund einer krisengeschüttelten Welt ist dieses Harmoniestreben aber auch verständlich. Man möchte sich keinem weiteren Angriff, keiner weiteren Infragestellung aussetzen. Entsprechend haben auch Kritiker*innen wenig Lust auf den Ärger, den sie sich mit einer negativen Rezension möglicherweise einhandeln könnten. Sie ziehen es vor, über von ihnen geschätzte Praktiken zu schreiben. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass künstlerische Arbeiten nun nicht mehr als „Problemzusammenhänge“ aufgefasst und folglich als etwas per se Anfechtbares diskutiert werden.
Stattdessen sieht man sich häufig mit kunstkritischen und kunsthistorischen Texten konfrontiert, die ihren Gegenstand mit affirmativen Bedeutungsgirlanden überziehen. Dass sich die Kritiker*innen zu dem von ihnen verhandelten Gegenstand positionieren, geschieht ebenfalls selten. Wenn Kritiker*innen jedoch keine Position beziehen, schwächen sie die Kritik von innen, verstärken ihre strukturelle Geschwächtheit sozusagen durch Selbstschwächung.
THESE 4: KUNSTKRITIKER*INNEN HABEN EIN NEUES BETÄTIGUNGSFELD FÜR SICH ENTDECKT: DEN MARKTBERICHT.
Seit dem Herbst letzten Jahres überschlagen sich die Meldungen über negative Entwicklungen auf dem Kunstmarkt. Beinahe täglich wird man online – etwa auf Artnet oder Artnews – mit neuen Hiobsbotschaften konfrontiert. Die Umsätze von Galerien und Auktionshäusern gingen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um bis zu dreißig Prozent zurück , auf Auktionen bleiben Arbeiten von früheren Marktstars wie Alberto Giacometti liegen , und die zuvor hohen Umsatzvolumen von Künstler*innen wie Andy Warhol oder Gerhard Richter schrumpfen. Von einem extremen Abwärtstrend ist auch die Londoner Filiale von Hauser & Wirth betroffen, die Berichten zufolge einen Gewinneinbruch von neunzig Prozent zu verzeichnen hat. Auch wurden zahlreiche Galerien aus dem mittleren Segment wie Blum Gallery und Venus Over Manhattan im Sommer dieses Jahres geschlossen. Zudem wird Pace demnächst ihre Filiale in Hongkong aufgeben, und Almine Rech schließt ihre Londoner Dépendance. In den Berichten, die diese Entwicklungen kolportieren, wird oft ein apokalyptischer Ton angeschlagen, so als stünde der Untergang des Kunstmarkts unmittelbar bevor. Bei genauerer Betrachtung sind die Umsätze im oberen Segment des Kunstmarkts allerdings immer noch hoch – wenn auch signifikant geringer als zuvor. Es handelt sich also häufig um Klagen auf hohem Niveau.
Angesichts der nicht abreißen wollenden Serie von bad news forderte Kenny Schachter – selbst Verfasser zahlreicher Abgesänge auf den Kunstmarkt – seine Kolleg*innen kürzlich dazu auf, mit dem ewigen „complaining“ aufzuhören. Zwar ist ihm insofern zuzustimmen, als negative Marktberichte den Abwärtstrend intensivieren. Denn diese Krise ist in erster Linie eine Vertrauenskrise, was Marc Glimcher, CEO von Pace, in einem Interview kürzlich betonte: „People start losing confidence.“ Das Vertrauen schwindet in einem unsicheren Marktumfeld. Man kann davon ausgehen, dass vor allem die an schnellen Profiten orientierten „spec collectors“ (Schachter) angesichts der Nachrichten über sinkende Auktionspreise vor Käufen zurückschrecken. Zudem ist der alte Typus des*der informierten Connaisseur-Sammler*in, der*die Texte liest, langfristig denkt und gegen den Strom schwimmt, vom Aussterben bedroht. Das heißt, es gibt kaum noch Sammler*innen, die in Zeiten sinkender Preise künstlerische Arbeiten mit hohem Symbolwert günstig erwerben.
Zurück zu Schachter und seiner Kolleg*innenschelte. Zwar ist ein Überdruss an Schreckensmeldungen nachvollziehbar, dennoch übersieht er meines Erachtens etwas Entscheidendes: den inneren Zusammenhang zwischen Kritik und Krise. Beide bedingen schließlich einander, wie schon Reinhart Koselleck festhielt : Die Kritik braucht zu ihrer Daseinsberechtigung die Krise, und umgekehrt verlangt die Krise nach Kritik. Nur: Während Koselleck, ähnlich wie Schachter, der Auffassung war, dass die Kritik die Krise nur herbeischreibe, kommt ihr aus meiner Sicht speziell in Krisenzeiten die Aufgabe zu, die sich in ihrer Ökonomie abzeichnenden Veränderungen mit feinen Antennen zu registrieren und zu analysieren. Statt den neuerlichen Strukturwandel der Kunstökonomie nur in Form von Marktreportagen abzubilden, sollte ihn die Kunstkritik daher historisch einordnen und gesellschaftstheoretisch deuten. Um einen solchen Versuch handelt es sich hier.
THESE 5: DIE KUNSTÖKONOMIE IST EINE „ECONOMY OF QUALITIES“, DIE VON IHREN AKTEUR*INNEN UNAUSGESETZT REFLEKTIERT UND BESPROCHEN WIRD.
Dass sich zahlreiche Akteur*innen des Kunstmarkts derzeit verstärkt mit dessen Krise befassen, liegt meines Erachtens an der Besonderheit dieser Ökonomie. Ich möchte daher den Vorschlag machen, die Kunstökonomie mit Michel Callon, Cécile Méadel und Vololona Rabeharisoa als eine „Economy of Qualities“ anzusehen. Eine solche Ökonomie zielt in erster Linie auf die Qualifizierung und Positionierung ihrer Produkte. In der Kunstökonomie geht es dementsprechend darum, ihren Produkten – sprich Kunstwerken oder Projekten – ein Profil zu geben, sie zu singularisieren. Als zusätzliches Merkmal der „Economy of Qualities“ heben Callon, Méadel und Rabeharisoa ihren reflexiven Zug hervor. Die Teilnehmer*innen dieser Ökonomie tauschen sich ständig über deren Zustand und Organisationsform aus. Somit sind die zahlreichen Wortmeldungen zur aktuellen Kunstmarktkrise auch Ausdruck des reflexiven Charakters dieser Ökonomie. Nehmen wir den bereits erwähnten Marc Glimcher, der den aktuellen Zustand des Kunstmarkts mit dem dramatischen Bild eines Zugunglücks veranschaulicht hat: „The art market is a train wreck everywhere and that’s ok. It’s long overdue.“ Glimchers Metapher impliziert einerseits, dass es sich bei der aktuellen Kunstmarktkrise um nichts Geringeres als um eine Katastrophe handelt, die intensive Aufräumarbeiten erfordern wird. Doch andererseits findet er diese katastrophale Entwicklung völlig in Ordnung, da sie schon lange fällig gewesen sei, frei nach dem Motto: Auf jeden Aufschwung folgt nun einmal der Abschwung. Auch der Galerist Tim Blum, der seine Galerie in diesem Sommer nach dreißig Jahren zu schließen beschloss, führt deren Ende in nicht minder dramatischen Worten auf ein nicht mehr funktionierendes „System“ zurück. Nicht sein eigenes unternehmerisches Handeln, sondern das „System“ sei demnach verantwortlich für die Schließung. Wobei Blum mit dieser Betonung der strukturellen Dimension seines Scheiterns auch recht hat, ist die derzeitige Krise doch auch eine Krise des Modells „Galerie“. Blum führt dazu aus, dass Galerien, um wettbewerbsfähig zu bleiben, an immer mehr Messen teilnehmen und die dort hohen Standmieten einspielen müssen. Diesem Expansionsimperativ könne man auf die Dauer nicht entsprechen. Dem von ihm genannten Krisensymptom ist noch hinzuzufügen, dass speziell die Galerist*innen aus dem mittleren Segment ständig damit rechnen müssen, ihre markterfolgreichen Künstler*innen an größere Player wie Gagosian oder Hauser & Wirth zu verlieren, die sie abwerben. Zudem können sie aufgrund hoher Betriebskosten heute nicht mehr wie früher als „risk taker“ agieren. Sie sind vielmehr ausgesprochen risikoscheu, da sie sich Ausstellungen mit schwer verkäuflichen Arbeiten junger Künstler*innen schlicht nicht leisten können. Einige Galerien verlangen von ihren Künstler*innen mittlerweile sogar, die Lager- und Produktionskosten selbst zu tragen. Das wäre in den 1990er Jahren undenkbar gewesen. Junge Künstler*innen setzen daher häufig auf andere Vertriebswege wie Instagram, die allerdings mit neuen Abhängigkeiten einhergehen.
Blum macht zuletzt auf ein ideelles Defizit aufmerksam, das mit Blick auf die Lage der Kritik aufschlussreich ist: Auf der jüngsten Art Basel habe er kein einziges „sinnvolles Gespräch“ geführt. Zwar erwähnt er an dieser Stelle nicht, dass auch Small Talk meaningful sein kann. Entscheidend ist jedoch aus meiner Sicht seine Beobachtung einer ausbleibenden inhaltlichen Diskussion in der merkantilen Sphäre. Die Tatsache, dass man sich auf Messen immer weniger über Kunst austauscht und dort kaum jemand zu sagen weiß, was in einer künstlerischen Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Spiel steht, ist ebenfalls eine Folge der Marginalisierung der Kunstkritik in dieser Sphäre.
THESE 6: SEIT DEN 1960ER JAHREN HAT DIE KUNSTKRITIK KONTINUIERLICH AN EINFLUSS VERLOREN.
Dass in einer „Economy of Qualities“ wie der Kunstökonomie sämtliche Akteur*innen mit der Qualifizierung und Positionierung der Produkte befasst sind, habe ich bereits ausgeführt. Der Kunstkritik kommt in diesem Prozess der Bedeutungszuschreibung eine besondere Rolle zu: Allein durch die Auswahl bestimmter Kunstwerke, die sie für außergewöhnlich erklärt, treibt sie deren Singularisierung und damit eben auch Wertbildung voran. Das ist ihre Aufgabe. Im Rahmen des von Cynthia und Harrison White so genannten dealer-critic system, das sich im späten 19. Jahrhundert herausbildete und das Salonsystem ablöste, oblag es tatsächlich den Kritiker*innen, Kunstwerke auf diese Weise zu profilieren und gemeinsam mit den Händler*innen zu positionieren. Doch spätestens in den 1990er Jahren wurde dieses dealer-critic system durch das von mir an anderer Stelle so genannte dealer-collector-curator system abgelöst. Nun waren es die Kurator*innen und Sammler*innen, die für den Prozess der Wertbildung maßgeblich verantwortlich zeichneten. Im Zuge der unaufhörlich voranschreitenden Ökonomisierung des künstlerischen Feldes verloren die Kritiker*innen an Einfluss. Einen weiteren Strukturwandel der Kunstökonomie, der eine Schwächung der Kunstkritik implizierte, habe ich 2022 unter dem Stichwort der „Resortisierung“ verhandelt und unter anderem die Tendenz der Megagalerien beschrieben, ihre Filialen in den Luxusenklaven der Reichen zu eröffnen: an Orten wie Aspen, Monaco oder Menorca, wo sie mit wohlhabenden Sammler*innen weitgehend unter sich bleiben. Überspitzt formuliert, handelt es sich bei diesen Kunstresorts um intellektuellenfreie Zonen, denn Kritiker*innen suchen sie schon aufgrund hoher Reise- und Aufenthaltskosten allenfalls noch im Rahmen bezahlter Pressereisen auf. Der Resortisierungsprozess findet meines Erachtens aber auch online statt – etwa auf Instagram, wo der Rückzug in resortartige Bubbles, in denen nur Gleichgesinnte aufeinandertreffen, zu beständiger gegenseitiger Bestätigung führt. Die Kritik steht auch hier auf verlorenem Posten.
THESE 7: WIE SICH IN DER MODEWELT BEREITS ZEIGT, FOLGT AUF JEDES ATTACHMENT DAS DETACHMENT.
Dass der zeitgenössische Kunstmarkt auf konjunkturelle Schwankungen besonders empfindlich reagiert, hat Raymonde Moulin bereits in den 1990er Jahren festgestellt. Auch die Unsicherheiten der heutigen Zeit mit ihren Kriegen, Wirtschaftskrisen, Klimakatastrophen und unberechenbaren rechtspopulistischen Politiker*innen haben unmittelbare Auswirkungen auf den Kunstmarkt. In einem solchen Umfeld fällt es schwer, die für den Prozess der Wertbildung so zentralen „positiven Zukünfte“ zu imaginieren. Analog zu anderen Märkten durchläuft auch der Kunstmarkt Zyklen: Auf jeden Höhenflug folgt ein Crash, auf jede Rezession ein Boom. Speziell der Kunstmarkt neigt dazu, sich sehr schnell zu erholen, wie man kürzlich auf der Art Basel Paris erleben konnte. Zahlreiche Galerist*innen mussten täglich umhängen, weil sie ihren Stand ausverkauft hatten. Nur schien sich dieser Höhenflug eher eines „Paris-Effektes“ als einer allgemeinen Marktstabilisierung zu verdanken. Auf jeden Fall müssen die Akteur*innen dieser „Economy of Qualities“ damit rechnen, dass jedes Attachment irgendwann in Detachment umschlägt (und umgekehrt). Konsument*innen, die sich affektiv an bestimmte Produkte gebunden haben, wenden sich also irgendwann wieder von ihnen ab: „All attachment is constantly threatened.“ Mit Blick auf diese grundsätzlich prekäre Produktbindung könnte man sagen, beim Wettbewerb unter Galerist*innen geht es vor allem darum, das Detachment der eigenen Sammler*innen möglichst lange hinauszuzögern. Dem steht jedoch die gestiegene Macht der Auktionshäuser entgegen. Wenn Kunstwerke auf Auktionen massive Preisstürze erfahren oder gar liegen bleiben, kann das nicht nur das Ende einer künstlerischen Karriere bedeuten, sondern auch dazu führen, dass Sammler*innen die Arbeiten von Künstler*innen mit geringem Marktwert meiden. Auch in puncto Preisbildung sehen sich Galerien durch Auktionshäuser in die Enge getrieben. Sie müssen ihre Preise den niedrigen Auktionspreisen anpassen, was früher tabu war, weil es Kund*innen verärgerte, die Arbeiten zuvor teurer gekauft hatten. Zahlreiche Sammler*innen meiden inzwischen nach meiner Beobachtung den Primärmarkt und gehen stattdessen auf Schnäppchenjagd bei Provinzauktionen.
Vergleichbares spielt sich in der Modewelt ab: Analog zum oberen Segment des Kunstmarkts kämpft auch die Luxusindustrie mit stark sinkenden Umsatzzahlen. Und Fashion-Fans kaufen nicht mehr in teuren Boutiquen ein, sondern erwerben Designermode zu Spottpreisen auf Plattformen wie Vinted. Laut Forbes sind auch wohlhabende Kund*innen der Luxusindustrie nicht mehr bereit, Preissteigerungen bei nachlassender Qualität hinzunehmen. Sie geben ihr Geld lieber für Erlebnisreisen, Wellness-Retreats oder Longevity-Behandlungen aus – eine Entwicklung, die sich auch in der Kunstwelt abzeichnet.
Zudem ist analog zum Bedeutungsverlust der Kunstkritik im kommerziellen Segment der Kunstwelt auch die Modekritik ins Hintertreffen geraten. Es mag noch einige Modeblogger*innen oder Beiträge auf Instagram oder Substack geben, die Defilees kritisieren, in den großen Modemagazinen hingegen findet Kritik nicht mehr statt. Der Herausgeber eines solchen Magazins hat mir kürzlich hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass er kein kritisches Wort über die letzte Kollektion von Louis Vuitton publizieren dürfe, denn dies würde mit der Stornierung sämtlicher Anzeigen des Konzerns LVMH bestraft werden und käme einer Art beruflichem Selbstmord gleich. Zwar müssen auch die Autor*innen von Verrissen in der Kunstwelt mit Sanktionen rechnen – sie werden womöglich nicht mehr zum Dinner eingeladen oder mit dem Verfassen von Katalogtexten betraut. Zugleich höre ich aber oft speziell von Galerist*innen und Kurator*innen, dass sie die Gattung „substanziell argumentierender kritischer Text“ vermissen. Es besteht also noch Hoffnung.
THESE 8: DIE KUNSTWELT HAT EIN MILIEUPROBLEM, UND AUCH HIER KANN DIE KRITIK ABHILFE SCHAFFEN.
Als ich vor nunmehr vierzig Jahren damit begann, kunstkritische Texte zu schreiben, habe ich mich nicht nur für bestimmte künstlerische Praktiken begeistert, sondern auch für das Kunstmilieu. Ich hatte damals den Eindruck, hier würden die interessantesten und avanciertesten Debatten stattfinden. An solch einer Welt, in der es wirklich um etwas ging, wollte ich teilhaben. Heute stellt sich die Situation ganz anders dar. Zwar gibt es immer noch Segmente in der Kunstwelt, in denen theoretisch ambitionierte Diskussionen stattfinden. Aber vor allem im Blue-Chip-Bereich ist der Aspekt Geld in den Vordergrund getreten. Während das symbolische Kapital der Kritiker*innen und Theoretiker*innen in den 1990er Jahren noch hoch im Kurs stand, kann man heute beobachten, wie sich zahlreiche Akteur*innen der Kunstwelt vor besonders markterfolgreichen Künstler*innen oder Sammler*innen-Millionär*innen in den Staub werfen. Oft sind sie finanziell zu diesem Kotau gezwungen. Nur wird dem Geld auf diese Weise absolute Autorität zugeschrieben, so, als sei der hohe Marktwert über alle Zweifel erhaben. Auch Auktionsergebnissen kommt inzwischen eine Deutungsmacht zu, über die früher autoritäre Kritiker*innen wie Clement Greenberg verfügten; sie können der Karriere von Künstler*innen einen Schub verleihen oder sie jäh beenden. Allerdings ist die Kunstwelt in demselben Maße, wie der ökonomische Imperativ in ihr regiert, unattraktiver für Kulturproduzent*innen aus anderen Branchen geworden.
Bei meinen Bekannten und Freund*innen aus der Film- oder Musikwelt beobachte ich jedenfalls, dass sie nur noch ungern zu Eröffnungen gehen, weil es dort sehr hierarchisch zugeht. Man gibt ihnen ständig zu verstehen, dass sie als mutmaßliche Nicht-Käufer*innen irrelevant sind. Beim Galeriedinner wird die Geldelite gern am Haupttisch platziert und von anderen abgeschirmt. Personen mit kulturellem Kapital müssen hingegen mit dem Katzentisch Vorlieb nehmen.
Ich denke, es bedarf vor diesem Hintergrund einer Art Neustart, bei dem kulturelles Kapital in seiner Bedeutung rehabilitiert und Kritik auch an den Werken markterfolgreicher Künstler*innen erwünscht ist und gefördert wird. Zudem sollte den Superreichen kein privilegierter Zugang zu Kunstmessen gewährt werden, wie jetzt auf der Art Basel Paris mit der „avant-première“, einer zusätzlichen Preview für Billionäre. Stattdessen könnte man Maßnahmen treffen, die die soziale Fluktuation fördern: Kunstmessen sollten von Anfang an für alle Interessierten geöffnet werden, so wie im 18. Jahrhundert die Salons, die auch klassenübergreifend frequentiert wurden – und aus diesem Grund sehr beliebt waren. Beim Galeriedinner könnte, wie bei kleineren Galerien häufig der Fall, auf die Tischordnung verzichtet werden, sodass sich dort Personen mit unterschiedlichen Geldhintergründen mischen. Zwar steht außer Frage, dass es eines Expert*innen-Wissens bedarf, um die Sprache der Kunst zu verstehen. Deshalb wird der Einstieg in die Gegenwartskunst immer an bestimmte soziale und intellektuelle Voraussetzungen geknüpft bleiben. Doch statt dieses Wissen aus der Marktsphäre auszugrenzen, sollte man es wieder in diese einbinden.
Sammler*innen mit Kritiker*innen zusammenzubringen, was früher die Regel war, geschieht heute jedoch nur in Ausnahmefällen. Sammler*innen könnten auf diese Weise mehr über den spezifischen (und immer nur situativ zu ermittelnden) symbolischen Einsatz bestimmter Kunstwerke erfahren und sich in Zukunft weniger an Preisen orientieren. Und umgekehrt könnten die Kunstkritiker*innen über die Funktionsweise einer Ökonomie informiert werden, der sie selbst angehören, obwohl sie sich oft außerhalb von ihr wähnen. Aber natürlich sind auch Kritiker*innen nicht zuletzt deshalb Akteur*innen des Marktes, weil sie an dem Prozess der Wertbildung teilhaben.
Angesichts des derzeitigen Strukturwandels der Kunstökonomie stellt sich zuletzt die Frage, ob uns ein Umbau des Kunstsystems bevorsteht, wie er im späten 19. Jahrhundert erfolgte, als das dealer-critic system das Salonsystem ablöste, oder ob es sich nur um eine leichte Korrektur und Verschiebung handelt. Noch ist unklar, welche Akteur*innen in einem neuen System das Sagen hätten und welche Machtverhältnisse darin herrschen würden. Auch wenn das aus dem Mund einer Kritikerin nach Eigennutz und wishful thinking klingt: Ich bin mir sicher, dass die Kunstkritik eine maßgebliche Rolle bei diesem Strukturwandel spielen wird. Ihre Aufgabe wird sich nicht darin erschöpfen, ihre Krise zu analysieren oder als Agentin zu fungieren. Sie wird begründete Einwände gegen das auf dem Markt Gefeierte erheben und sich für bestimmte Positionen, ob markterfolgreich oder nicht, starkmachen. Auch weil sie online neue Formate entwickeln wird, wird man ihr mehr Aufmerksamkeit schenken und ihren Einfluss schätzen. Mich stimmt zudem optimistisch, dass Kritik im analogen Raum durchaus weiterhin stattfindet, zum Beispiel im Rahmen von privaten Situationen, in denen Freund*innen Ausstellungen kontrovers diskutieren. Gerade weil sie so oft totgesagt wurde, wird die Kunstkritik noch lange leben.
Redaktionelle Anmerkung: Einige Überlegungen und Formulierungen dieses Essays finden sich bereits im „Brief der Herausgeberin“, der am 1. November in unserem Newsletter verschickt wurde. Dieser Brief bildete die Vorarbeit für die Reflexionen in diesem Text.
Isabelle Graw ist Mitbegründerin und Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021), Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022) und Angst und Geld: Ein Roman (Spector Books, 2024).
Image credits: 1. Courtesy of the artist and Galerie Buchholz; 2. Courtesy Hauser & Wirth; 3. Courtesy Kenny Schachter; 4. Courtesy Pace Gallery, photo Suzie Howell; 5. © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain; 6. © TEXTE ZUR KUNST; 7. Courtesy @jerrygogosian
Anmerkungen