PAINTING BESIDE ITSELF Georg Imdahl über Taslima Ahmed in der Galerie Noah Klink, Berlin

„Taslima Ahmed: Reconstructor Paintings“, Galerie Noah Klink, Berlin, 2022, Ausstellungsansicht
Wie kein anderes Medium sucht die Malerei permanent nach Selbstbegründung. Es gehört zu ihrem diskursiven Grundrauschen, in ihrer Entwicklung (und hartnäckig behaupteten Agonie) ständig neben sich selbst zu stehen und sich zu beobachten. Auch darin bekundet sich die Sonderstellung dieser Formation innerhalb der bildenden Kunst – sie beharrt auf etwas, das theoretisch der Vergangenheit angehört: ihrer Medienspezifik. Weshalb die Liebe zur Malerei auch dort noch tief empfunden wird, wo ihre Selbstbespiegelung ironisch als „The Happy Fainting of Painting“ auf den Punkt gebracht wird. [1] In den letzten zehn Jahren, heißt es zur Ausstellung „Reconstructor Paintings“ von Taslima Ahmed auf der Homepage der Galerie Noah Klink, scheine sich die Geschichte der Malerei endgültig von ihren Schöpfer*innen gelöst zu haben, doch auch die Erzählung von „Epson-bedruckten Leinwänden und post-malerischen Gesten“ sei zum Stillstand gekommen – statt dessen richteten sich jüngste Hoffnungen auf NFTs. (Just während ich diese Zeilen schreibe, geht eine Mail zu „Nicole Eisenman & the Moderns“ im Kunstmuseum Den Haag ein, vorher in Bielefeld zu sehen; eine großartige Ausstellung, die durchaus noch Hoffnungen auf zeitgenössische Malerei von malenden Schöpfer*innen begründet.) Warum aber nicht die Rückkopplungen zwischen Mensch und Maschine als „Material für die Malerei verwenden“?, wird in der Ankündigung gefragt.
Mit dem Drucker arbeitet auch Taslima Ahmed. Die Einführung auf der Webseite lässt die Vermutung zu, sie wolle in der Nachfolge eines Wade Guyton verortet werden. Ihre acht annähernd gleich großen Mittelformate bei Noah Klink sind mit Photoshop und 3-D-UV-Technik auf synthetischer Leinwand entstanden; dabei werden die Pigmente schichtweise aufgetragen, bis sie sich als flache Reliefs erheben, sozusagen als Pseudo-Impasto. Die Technik kommt in der Blindenschrift zum Einsatz und ruft bei Sehenden, wenn sie den Bildern nahe genug kommen, den Wunsch hervor, sie zu berühren. Was sich im Procedere der Malerei eigentlich der Geste, also einer gewissen Spontaneität verdankt, ist hier maschinell ausgeführt, hat mit manueller Tätigkeit, mit „vitalistischen Phantasien“ also nicht viel am Hut, ganz zu schweigen von Assoziationen wie „Lebenskraft oder Beseeltheit“. [2] Völlig unbekannt ist dieser Gedanke nicht, er wurde früher bereits mit konventioneller Malerei ins Bild gesetzt – Jonathan Lasker hat in den 1980er Jahren seine Kritzeleien auf Papier im Großformat minutiös in fingerdicker Spachtelmalerei abgemalt und damit den Fluss der Handschrift in der bloßen Pose von Automatismus erstarren lassen. In den Prints von Ahmed ist selbst jene Pose von generischer Malerei mit technischem Gerät imitiert, lässt so etwas wie „Handschrift“ bestenfalls noch als fernes Echo nachhallen.

„Taslima Ahmed: Reconstructor Paintings“, Galerie Noah Klink, Berlin, 2022, Ausstellungsansicht
Ausgiebig traktiert Taslima Ahmed noch einmal das Figur-Grund-Thema, einen Klassiker des vorigen Jahrhunderts, der eigentlich auserzählt scheint, aber nicht kleinzukriegen und noch immer brauchbar ist. Bei Ahmed sind es zumeist pechschwarze Linien, geometrische oder nebelartige Formen und Schemen auf grellweißem Grund in einer klinisch-aseptischen Ästhetik, die sich idealtypisch in den White Cube einfügt, den der kürzlich verstorbene Brian O’Doherty (R. I. P.) unnachahmlich als Faktor von Kunstbetrachtung und Kunstbewertung im 20. Jahrhundert dargelegt hat. In den einzelnen Arbeiten dekliniert Ahmed verschiedene Interferenzen von künstlerischer Idee und digitaler Verarbeitung durch. Da wäre zum Beispiel ein Raster aus schwarzen Punkten, die an einigen Stellen wie verwischt oder verschmiert aussehen und eine „malerische“ Note ins Spiel bringen. Oder eine kleine, fette, digital rekonstruierte Linie auf weitem leerem Weiß, die als Spray anmutet, zumal am Ende ein kleiner Drip herabgeflossen scheint, was mich unweigerlich an Crapstraction und die sparsamen Setzungen von David Ostrowski denken ließ. Ein anderes Raster besteht aus einem Register aus 15 Quadraten, in denen sich jeweils eine Spur von rechts unten nach links oben erhebt. Es könnte sich um Siebdrucke handeln. Auch hier liegen Assoziationen nahe, die vom Phallus bis zur „Blotted Line“ à la Warhol reichen – tatsächlich führt der Titel Road (2022) auf eine andere Spur: Es handelt sich um eine Darstellung von GPS-Daten, die den Straßenverkehr von Elektroautos abbilden, offenbar zu unterschiedlichen Tageszeiten bei unterschiedlicher Verkehrsdichte. Wenn man Bilder zu „Paint Drip Brush“ googelt, findet man ähnliche gerasterte Darstellungen und Diagramme. Oder, noch ein anderes Beispiel: Die Künstlerin schickt Bilder in einen Algorithmus, der keinen Gegenstand erkennt, sondern nur Fleckengewirr, das er als Antwort ausspuckt.
Es sind solche Missverständnisse, in denen die Ausstellung mit ihren Bildern ohne eindeutige Autorschaft nach Mehrwert forschte: Die künstliche Intelligenz kommt mit bestimmten Sujets nicht klar, gibt sie rein schematisch wieder, generiert dadurch Fehler beziehungsweise Nichtverständnis und zugleich aber auch, als Resultat gescheiterter Kommunikation – Bilder.
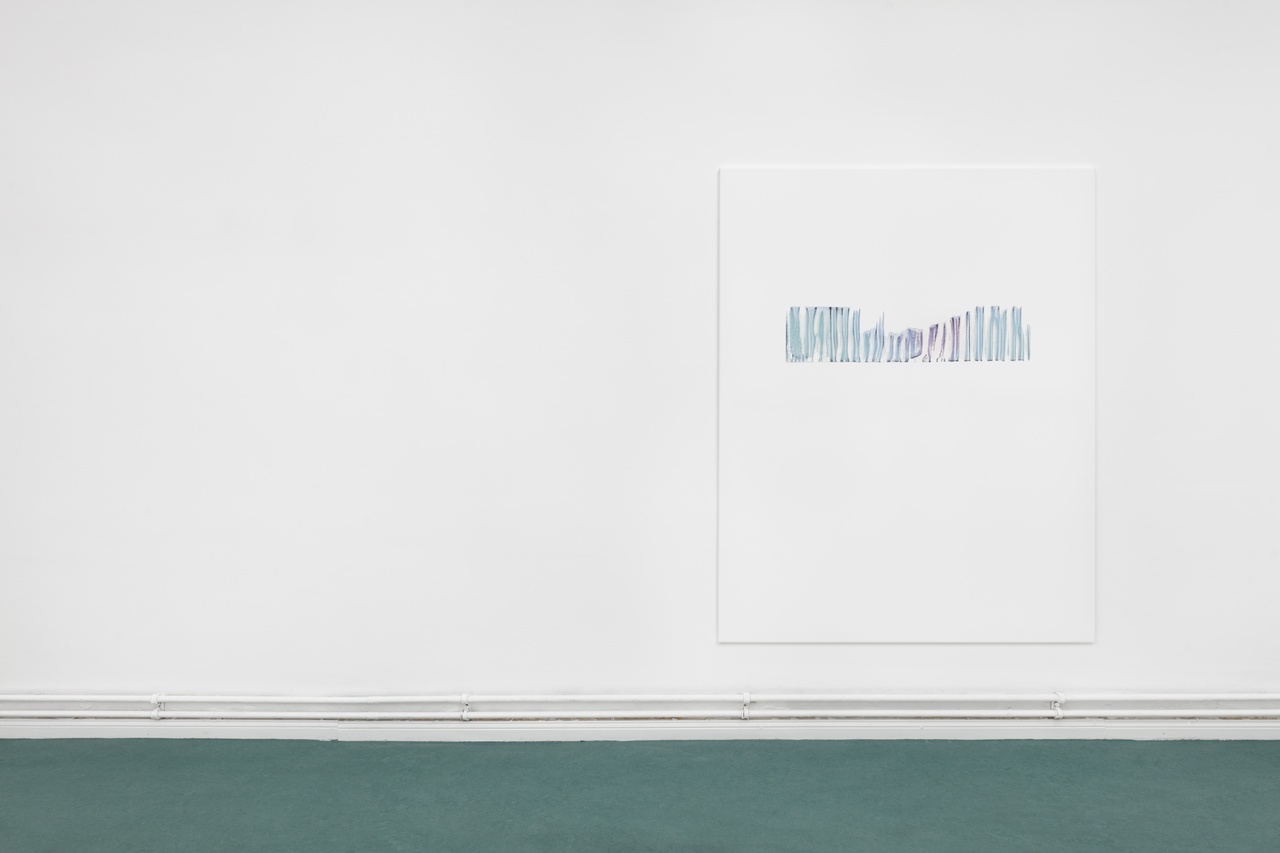
„Taslima Ahmed: Reconstructor Paintings“, Galerie Noah Klink, Berlin, 2022, Ausstellungsansicht
Farbe blieb in der Ausstellung weitgehend ausgespart, die Bilder bieten das Gegenteil von sinnlicher Opulenz, wie man sie etwa im bisherigen Werk von Tim Berresheim antrifft, der ebenfalls digital malt, oder wie Taslima Ahmed sie in früheren Ausstellungen bei Noah Klink an den Tag gelegt hat, sei es in Bildern von gestochener farblicher Brillanz wie in ihrer Screenshot-Serie (2020) mit blauen Karosserien oder, in eher trockenem Kolorit, in der Reihe Panofsky Principle (2021) mit Arbeiten, die nach europäischem Informel aussehen. Die Ausstellung mit den „Reconstructor Paintings“ erschien wie ein experimentelles Setup mit kryptischen Bildern, die jede Menge kunstaffiner Déjà-vu-Erlebnisse und Flashbacks bescheren, diese aber ins Leere laufen lassen.
Der Mensch tastet eine Fläche in der Regel mit den Augen nach Informationen ab und folgt dabei einem F- oder Z-Muster; er ordnet das Gesehene auch nach Mittelpunkten; ein Computer kann weder ,verstehen‘ noch negative Dialektik erzeugen; und er kann auch keinen Dalmatiner in einem Feld schwarzer Punkte erkennen. Zu jeder dieser Fehlfunktionen gab es in der Ausstellung ein Gemälde, hieß es in der Ankündigung. Genauso bot sich die Ausstellung tatsächlich dar. Daraus könnte sich ein ergiebiges, herausforderndes Dispositiv ergeben, wenn es ums Anzapfen hybrider Quellen der Bildentstehung geht – eben um die Interferenzen wie auch die Grenzen und Zwänge der digitalen und menschlichen Existenz. Dass die KI nicht weiß, wie wir denken, wir wiederum aber nicht, wie sie denkt, wird das Denken beider (wenn man es im Fall von KI so nennen kann) ja noch weiterhin beschäftigen, so auch Dinge wie Heatmaps, Z-Patterns oder Blackboxing, die in Ahmeds Arbeiten reflektiert werden. Es blieb aber in der Ausstellung, in meinen Augen, ein eher defizienter Modus von Erfahrung, der im Sinne von ikonischem Mehrwert produktiver gemacht werden könnte. Die einzelnen Arbeiten muteten an wie Belegstücke für bestimmte Fragestellungen bezüglich künstlicher Intelligenz und die Erkenntnis-Dispositionen von menschlicher und maschineller Wahrnehmung. Sie blieben eher trockene visuelle Sprachspiele und als solche in ihrer Haltung und künstlerischen Durchdringung indifferent. Daraus sollte sich noch mehr Kapital schlagen lassen. So aber steht die Malerei hier wirklich neben sich: painting beside itself.
„Taslima Ahmed: Reconstructor Paintings“, Galerie Noah Klink, 29. April bis 11. Juni 2022.
Georg Imdahl ist freier Kunstkritiker in Düsseldorf und Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie Münster.
Image credit: All images courtesy of the artist and Galerie Noah Klink, photos Hans-Georg Gaul
