STRATEGISCHER REALISMUS Inka Meißner über Iman Issa im Albertinum, Dresden

„Iman Issa: Das Spiel“, Albertinum, Dresden, 2025
In „Borges on the Couch“, schreibt David Foster Wallace über den argentinischen Autor Jorge Luis Borges, der unter anderem die Erzählung bzw. die Buchreihe Die Bibliothek von Babel (1941) verfasste, er sei „kein Metafiktionalist oder geschickt getarnter Kritiker“, sondern als Schriftsteller vor allem ein Leser. Seine „Geschichten sind introvertiert und hermetisch, mit dem unterschwelligen Schrecken eines Spiels, dessen Regeln unbekannt und dessen Einsatz alles ist“. [1] In ihrer Dresdner Ausstellung „Das Spiel“ bedient sich die Bildhauerin Iman Issa einer Generationen und Kulturkreise übergreifenden Bibliothek und arbeitet, ähnlich wie Borges, mit deren eigener Form der Kontingenz. [2] Gleichzeitig zeigt sie sich als geschickt getarnte Kritikerin und als Künstlerin, die auch Leserin ist. Während Issa vordergründig mit Fakt, Fiktion, Information und Projektion spielt, adressiert sie durch ihre ästhetischen Setzungen sehr konkrete Themenkomplexe und hebelt institutionelle Bedingungen aus. „Das Spiel“ wirkt auf den ersten Blick verhältnismäßig harmlos, auf den zweiten offenbart es die Schrecken von Krieg und kolonialer Gewalt.
Die zweiteilige Ausstellung beginnt, sofern man sich in Ausstellungen gern von unten nach oben bewegt, in der ebenerdigen Skulpturenhalle des Albertinums. Durchquert man das Labyrinth permanent installierter Skulpturen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, von der Moderne hinein in die Postmoderne, erreicht man am Ende der Halle – rechter und linker Hand von Werken Katharina Grosses, Tony Craggs und Isa Genzkens – zunächst eine Gruppe von Skulpturen und schließlich an der Stirnseite eine Serie von Fotografien, die als Kernstück von Issas Ausstellung anlässlich des Ernst-Rietschel-Kunstpreises für Skulptur 2024 [3] verstanden werden können.

Iman Issa, „Proxies, with a Life of Their Own“, seit 2020
Positionierung und Farbigkeit der sich gegenüberstehenden Skulpturen im Raum erinnern an das Schachspiel und damit an eines der ältesten bekannten, mit Kriegführung assoziierten Spiele. Die Gruppe besteht aus vier Arbeiten der für das bisherige Werk der Bildhauerin beispielhaften Serie Proxies, with a Life of Their Own (seit 2020): Monochrome, auf eine ovale Form reduzierte und in 3D gedruckte Porträts, die durch je zwei Stangen mit Abstand zur Wand befestigt sind, werden durch Wandlabels einer Person, die in diesem „Self-Portrait, Self as …“ als Alter Ego der Künstlerin fungiert, und einer spezifischen Qualität deren Schaffens zugeordnet. Die weißen Skulpturen auf der einen Seite sind als Hannah Arendt und der ägyptische Dichter und Schriftsteller Georges Henein identifiziert. Arendt verkörpert beispielsweise die Scham und Henein das Schweigen. [4] Die gegenüberliegenden Skulpturen sind schwarz und vertikal in zwei Teile gesplittet. Hier wird das Selbst durch die ägyptische Feministin und Journalistin Doria Shafik und den früh erblindeten arabischen Schriftsteller Taha Hussein vertreten. Inwieweit Farbe und Form der jeweiligen Skulptur symbolisch zu lesen sind, bleibt spekulativ. Deutlich wird hingegen eine Beschäftigung mit Text als Medium der ästhetischen, biografischen und historischen Auseinandersetzung – eine enzyklopädische Dimension, die über Orte, Zeiten und Disziplinen hinausgeht. Die Skulpturen selbst sind so dem erzeugten Denkraum eher nachgeordnet. In ihrer reduzierten Ausführung als organisch gerundete Körper, die zunehmend gespalten sind, dadurch Kanten und unweigerlich einen weiteren Abstraktionsgrad erreichen, führen sie ein generatives Moment von zum Beispiel Text gleichzeitig aber auch sehr konkret selbst auf.
Am Ende der Halle und im Zentrum der Ausstellung hängt die Serie Das Spiel (2025), die eigens dafür produziert wurde. Sie besteht aus zehn Fotografien, unter denen jeweils eine Reihe möglicher Beschriftungen direkt auf die Wand appliziert ist. Um der „korrekten“ Beschriftung auf die Spur zu kommen, gibt ein weiterer Wandtext Hinweise zu jeder einzelnen Fotografie. Die Bildunterschriften sind in der Regel so strukturiert, dass auf einen Gegenstand ein Ort und eine Jahresangabe folgen. Die Hinweise hingegen werfen unterschiedliche Formen von Information in den Raum (Autor*innen, Publikationsdaten spezifischer Bücher, biografische Informationen), die den Beschriftungen eine gewisse Lesart anbieten, zum Beispiel „Photo (P3): Mahmood Mamdani’s book was published in 2001“. Die Fotografien selbst bewegen sich alle in einem von Schwarz, Braun, Rot, Ocker und Beige bestimmten Farbspektrum. Bilder, die Wüsten- oder Steinformationen zeigen, alternieren und überlappen mit bibliophilen Motiven: (leeren) Buchseiten, Archivierungsmöbeln. Lebewesen, hier Flora und Fauna, sind entweder ausgestopft, verblüht oder sehr unscharf wiedergegeben. Sie suggerieren alle ihren eigenen Tod, nicht zuletzt dann, wenn sie im Museumsdisplay zu sehen sind, wie zum Beispiel das Bild eines ausgestopften, ausgeleuchteten Ochsen, der auch das Ausstellungsplakat ziert.
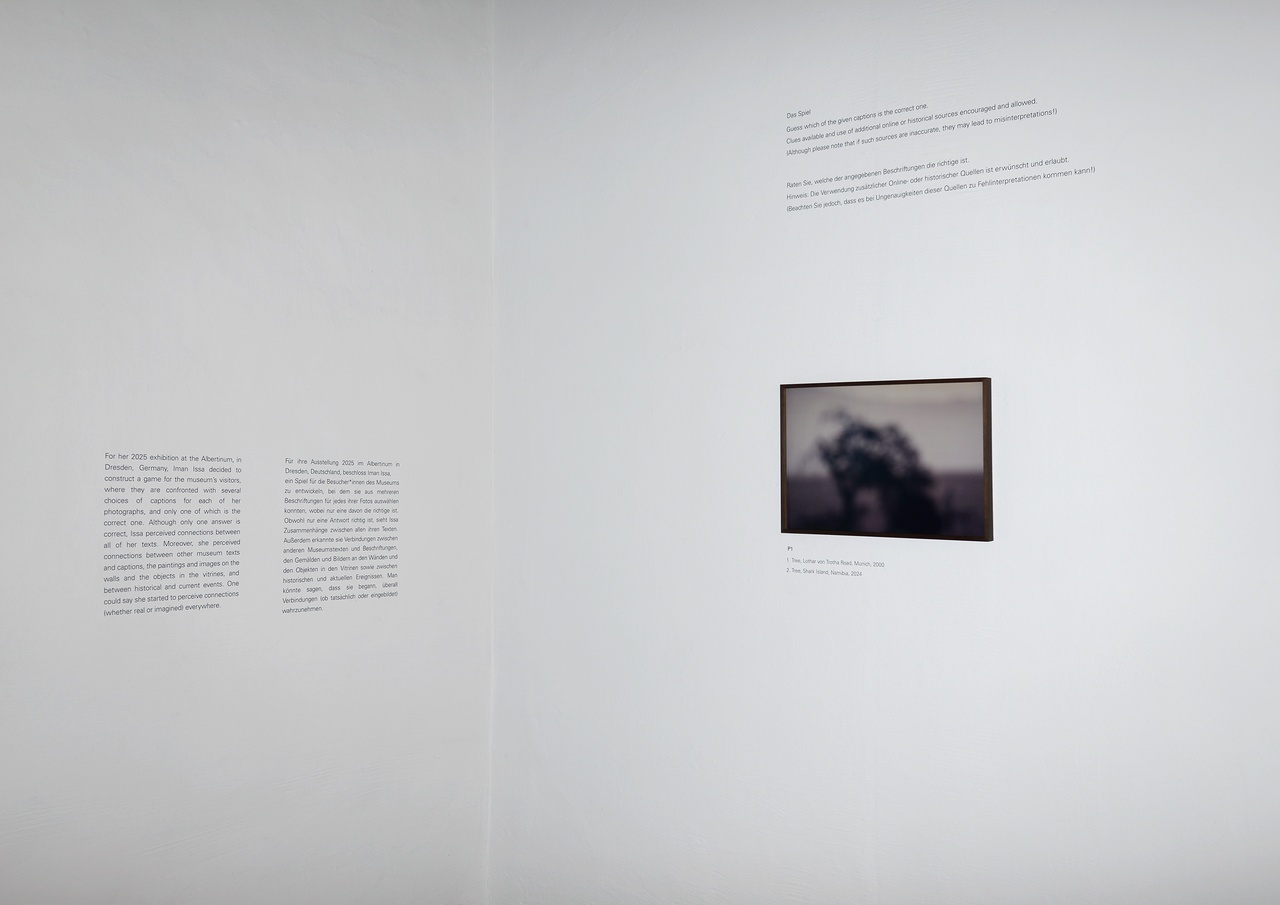
„Iman Issa: Das Spiel“, Albertinum, Dresden, 2025
Die Motive per se haben eine unklare Herkunft und ein unklares Interesse; in gewisser Weise entziehen sie sich so zunächst einer dezidierten künstlerischen Autor*innenschaft. Tatsächlich könnte es sich auch um auf Basis der zur Auswahl stehenden Beschriftungen von KI generierte Bilder handeln. Das einzelne Bild befriedigt weder einen Voyeurismus, noch schließt es die Rezeption des Kunstwerks ab. „Das Spiel“ aktiviert eher, als dass es informiert. Und auch wenn die Serie damit auf recht klassische konzeptkünstlerische Operationen verweisen könnte, verlangt sie vor allem, an Rezeptionslogiken außerhalb der Traditionen bildender Kunst und visueller Kommunikation weitergereicht zu werden – in erster Linie an das Lesen. Issas Ausstellung „Photograph – (Un)Like (M)Any Other(s)“ in der kommerziellen Galerie Carlier Gebauer in Berlin 2024 kann sicherlich als Vorläuferin dieses Konzepts einer Indienstnahme der Fotografie im Werk einer Bildhauerin betrachtet werden, das mit „Das Spiel“ nun in einer deutschen staatlichen Institution fortgesetzt wird. Der Titel von Issas Anfang Mai eröffneter Ausstellung im Art Institute of Chicago, „A Game, or So You May Think“, wäre dann eine Fortführung.
Folgt man der Aufforderung des Wandtextes, rät, „welche der angegebenen Beschriftungen die richtige ist“, und folgt weiterhin dem „Hinweis: Die Verwendung zusätzlicher Online- oder historischer Quellen ist erwünscht und erlaubt – (Beachten Sie jedoch, dass es bei Ungenauigkeiten dieser Quellen zu Fehlinterpretationen kommen kann!)“ [5] –, ergibt sich folgender Spielverlauf: Issa bietet eine Ausgangsinformation an, die relativ barrierefrei [6] so weit recherchiert werden kann, bis eine koloniale Gewaltform sichtbar wird, die Bezüge herstellt zu verschiedenen Ebenen aktueller und historischer Konflikte. Hat man das Spiel beendet, sprich, alle Bilder soweit wie möglich dechiffriert, wird erkennbar, mit welcher Dringlichkeit die Künstlerin den Israel-Palästina-Konflikt und den Umgang der deutschen Politik mit propalästinensischem Aktivismus thematisiert. Die Installation erlaubt anhand von Verweisen auf komplexe, im Rahmen von Lebenswerken ausformulierte, teilweise von der Geschichte selbst modifizierte Konzepte ein indirektes und subtiles Sprechen über diese politischen Verhältnisse. Sofern den Quellen also nachgegangen wird, könnte man im Sinne Bernard Stieglers argumentieren, dass auf diese Weise eine mitunter „disruptive“ [7] Historisierung umgangen wird, für die man immer schon „zu spät“ ist. Stattdessen fängt die Arbeit hier erst an: In den undefinierten Bildern mit Multiple-Choice-Captions – Prototypen eines generischen Meme-Formats – versteckt sich eine analoge Kommunikation, die wiederum digitale Informationen via Netz-Research nutzt, um kulturelles Erbe, soziopolitische Regionen und intellektuelle Konzepte so zu verschränken, dass ein nichtkontrolliertes, kontingentes, deswegen aber nicht unpräzises Wissen um eine Situation produziert wird. [8]

Iman Issa, „Das Spiel“, 2025
Das erste Bild der Serie markiert gleichzeitig eine Verbindung zu einem vorausgegangenen Projekt des Albertinums, das die Historisierung des Genozids der deutschen Kolonialmacht an den Nama und Ovaherero in Namibia in den musealen Institutionen beforscht und damit auch Formen der Enteignung in den Fokus genommen hat: Mit Lothar von Trotha und Shark Island benennen die beiden Bildunterschriften einen der Verantwortlichen sowie einen der zentralen Orte des Genozids. Ursprünglich unter dem Titel „Das Jahr 1983“ für Juni 2024 geplant, wurde die SKD-Ausstellung aufgrund eines erinnerungspolitischen Streits mit der Gastkuratorin Zoé Samudzi abgesagt, die dafür entstandene Arbeit „Der deutschkoloniale Genozid in Namibia: Shark Island und Swakopmund“ von Forensic Architecture dann aber im Herbst 2024 gezeigt. [9] Ohne einen expliziten Bezug zu der am Ende nicht stattgefundenen Ausstellung herzustellen, nimmt Issa diesen Faden auf. Ihr Spiel zielt laut Ausstellungstext auf die Beobachtung ab, „wie der jeweilige Kontext die Wahrnehmung beeinflusst“ [10] – im Umkehrschluss, was passieren kann, wenn dieser Kontext enteignet wird. Eine solche Form der Negation, die hier als spezifisch nichtdisruptive Qualität der Kritik in den Setzungen der Künstlerin erkennbar wird, verdeutlicht sich am besten an einem konkreten Beispiel.
Eine unscharfe Fotografie zeigt einen Ausschnitt eines alten Möbelstücks, auf dem sich ein halb abgelöster, mit Fac-similés beschriebener Aufkleber befindet. Die Beschriftungsoptionen bieten ein „Wanddetail“ an, das sich entweder im Juryraum der Berlinale 2024, dem des Venedig Filmfestivals 1966 oder im Senderaum des Rundfunks der DDR im Funkhaus Berlin im Jahr 1971 befindet. Oder aber: „none of the above“ (wofür die französische Beschriftung Fac-similés sprechen würde). 1966 wurde der Film Schlacht um Algier des Journalisten Gillo Pontecorvo in Venedig gezeigt. Dieser Film war bis 1971 aufgrund seiner kolonialkritischen Perspektive in Frankreich und England verboten, während er mittlerweile als Paradebeispiel für ein aufklärendes Kino gilt. 2024 gewann zwar der Film No other Land des palästinensischen Regisseurs Basel Adra und des israelischen Journalisten Yuval Abraham den Goldenen Bären für Dokumentarfilm, die Preisverleihung auf der Berlinale hingegen geriet zu einem Skandal, der paradigmatisch für den Konflikt zwischen dem Vorwurf des Antisemitismus vonseiten der deutschen Politik und den Vertreter*innen eines propalästinensischen, israelkritischen Protests gelesen werden kann. Der Verweis auf das Funkhaus Berlin hebt diesen Komplex schließlich auf die etwas abstraktere Ebene von Fragen nach so etwas wie Staatsdoktrin. 1971 wurde beispielsweise das für sowohl West- als auch Ostberlin produzierte Programm „Berliner Welle“ auf Initiative des Ministerrats der DDR eingestellt und durch die „Stimme der DDR“ ersetzt.

„Iman Issa: Das Spiel“, Albertinum, Dresden, 2025
Im zweiten Teil der Ausstellung, im dauerhaft installierten Schaudepot für Kleinskulpturen im zweiten Stock des Albertinums, wird Issas Interesse am Dispositiv Museum noch in einer anderen Facette deutlich, und die Geste der Enteignung, derer sie sich bedient, weitet den Horizont der Rezeption auf andere Praxen neuer Konzeptkunst und zeitgenössischer Institutionskritik aus. Auf der schwarz gestrichenen Wand vor den zweistöckigen Glasvitrinen, in denen Bronzen, Abgüsse, Stein- und Keramikskulpturen ausgestellt sind, deren Titel, Produzent*in und Entstehungsjahr auf unterschiedlich vergilbten Zetteln – angebracht an oder neben der Arbeit – vermerkt sind, steht die Aufforderung zu raten, „welches dieser Werke die richtige Beschriftung trägt und welches eine Beschriftung hat, die zu einem anderen Werk gehört“. Das fordert nicht nur dazu auf, jeden einzelnen Zettel anzuschauen, sondern auch jede Variation als potenzielle, (kritisch) aufgeladene künstlerische Setzung zu identifizieren und zu interpretieren. Schnell wird klar, dass es weder eine Auflösung des Rätsels vonseiten der Künstlerin gibt noch einen roten Faden, der sich aus den eigenen Beobachtungen herauskristallisieren lässt. Enteignet wird hier die Autorität der musealen Setzung und damit die Stimme der Institution, die sich die Künstlerin selbst aneignet, indem sie ihre eigene an deren Stelle setzt. Das produziert erst mal ein Gefühl der Leere, eine Abwesen- und Unsicherheit, die im Umkehrschluss unsere eigenen Abhängigkeiten spürbar werden und mich an Strategien und Fragestellungen denken lässt, wie sie in aktueller Institutionskritik aus der Perspektive des Disability-Diskurses verhandelt werden. [11] Issas Spiel rückt unsere Abhängigkeit von richtungweisender Autorität in den Fokus. Und obwohl Spielregeln an sich häufig nicht weniger autoritär, wenn auch mitunter intransparenter als Museumskonventionen sind – sie fordern dazu auf, strategisch zu denken, aber grenzen die möglichen Strategien durchaus ein –, wird die Ausstellung zu einem wirklich interessanten Vorschlag, die Reproduktion dieser Autorität nicht als Bedingung für Kritik anzuerkennen.
Image Credits: © Hans-Peter Klut/ Elke Estel / Albertinum, courtesy carlier | gebauer
Inka Meißner ist Künstlerin und Autorin, sie lebt in Berlin und arbeitet als Senior Artist in der Klasse für künstlerische Fotografie an der Kunstuniversität Linz. Im letzten Jahr hat sie ein Dissertationsprojekt zum Thema des Psychopathen als künstlerische Narration kapitalistischer Gewalt beendet.
„Iman Issa: Das Spiel“, Albertinum, Dresden, 8. Februar 2025 – 11. Mai 2025
ANMERKUNGEN
| [1] | David Foster Wallace, „Borges on the Couch“, in: New York Times, 7. November 2004 [übers. von IM]. |
| [2] | Niemand kann jemals alles gelesen haben oder allen Bezügen nachgehen. |
| [3] | Ausschlaggebend für die Auszeichnung war laut Pressemitteilung des Albertinums, dass „die Geschichte von Museen und Sammlungen ein Schwerpunkt ihrer Arbeit [ist], in der sie sich mit den Orten, den Werken und ihren Displays auseinandersetzt“. Darüber hinaus der von der Jury hervorgehobene, vielleicht aktuellere Bezugspunkt: Issa verhandele „in ihrem Werk die politische Ästhetik unterschiedlicher Gegenwarten“. Siehe hier. |
| [4] | „Self as Hannah Arendt who, when confronted with Germans declaring themselves ashamed of being German, does not mention that she is in fact ashamed of being human“, siehe Self-Portrait (Self as Hannah Arendt), siehe Wandetiketten Albertinum Dresden. |
| [5] | Wandtext, Albertinum Dresden, Erdgeschoss. |
| [6] | Sofern man über Internet, Smartphone, Computer etc. verfügt oder in letzter Instanz Zugang zu einer sehr gut sortierten Bibliothek hat. |
| [7] | Bernard Stiegler, In The Age of Disruption. Technology and Madness in Computational Capitalism, Cambridge 2019, S. 8. |
| [8] | Da Stieglers „disruptiv“ aus der Beschäftigung mit der binären Logik des Algorithmus herrührt, schaue ich mir hier allerdings eine bestimmte Qualität von Kritik in dem Bewusstsein darüber an, ein politisches Problem mit einem technologischen zu adressieren. |
| [9] | „Forensis / Forensic Architecture: Der deutschkoloniale Genozid in Namibia: Shark Island und Swakopmund“, Albertinum, Dresden, 15. Oktober bis 17. November 2024, siehe “Forensis / Forensic Architecture”; siehe z.B. Lisa Bernis, „Ausstellung in Dresden geplatzt: ‚Tieftraurig und gedemütigt‘“, in Frankfurter Rundschau, 25. Juni 2024. |
| [10] | Siehe: “Iman Issa: Das Spiel”. |
| [11] | Seit 2020 fordert Park McArthur in ihren Ausstellungen zum Beispiel die „locality“ heraus, was durchaus als Enteignung des Konzepts der Ortsspezifik verstanden werden kann. In McArthurs Praxis wird deutlich, wie die Institution von der Anwesenheit der Kunstobjekte und der Körper der Künstler*innen und Besucher*innen im Raum des Museums abhängig ist, um Wert zu produzieren, und eine Möglichkeit erfahrbar, „to claim the site without reproducing institutional property.“ Siehe: Geelia Ronkina: „To Live Not in but as Daydream: ‚On Projects 195: Park McArthur‘“ in The Contemporary Journal, 9. März 2020. |

