TOTE SCHREIBEN BESSER Diedrich Diederichsen über Roberto Bolaños „Cowboygräber“
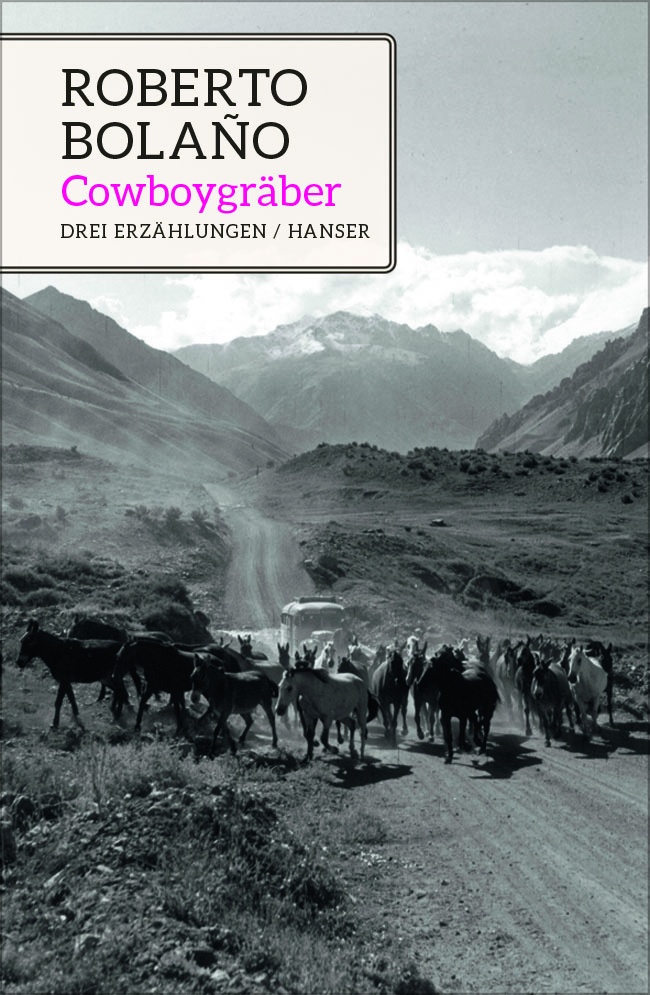
Der Kurs Frankfurt–Buenos Aires war der längste Nonstop-Flug im alten Lufthansa-Fahrplan. Von diesem in einer Nacht des argentinischen Sommers 2002 nachhaltig durchgeschüttelt und gerädert, taumelte ich in mein Hotelzimmer unweit vom Ufer des Rio de la Plata, um mein verhangenes Hirn mit dem üppigen Angebot lateinamerikanischer Kabelfernsehsender wachzuhalten. Ein viel zu lebhafter junger Mann mit dichten Augenbrauen weckte mich nachhaltig. Mit scharfen Worten in einem überaus klaren, in knappe Sätze gehackten Spanisch rechnete er mit der gesamten spanischsprachigen Literaturtradition ab, insbesondere an Pablo Neruda blieb kein gutes Haar. Eigentlich seien nur zwei Autoren dieser Tradition wirklich satisfaktionsfähig: der immerhin zu diesem Zeitpunkt schon seit 357 Jahren tote Francisco de Quevedo und – zur Freude der argentinischen Moderatoren – Jorge Luis Borges. Ich lernte dann bald in Buenos Aires reichlich Fangirls und -boys kennen, die mir mehr von dem faszinierenden Polemiker berichten konnten. Ein gutes halbes Jahr später starb Roberto Bolaño 50-jährig an Hepatitis.
Die massive globale Rezeption und auch mein eigenes unersättliches Lesen dieses Autors begann also posthum. Seit Jimi Hendrix war kein toter Künstler mehr so produktiv wie Bolaño. Damit ist sein Werk das Gegenteil all der auch für diese Zeitschrift kürzlich so relevanten autofiktionalen Autor*innen wie Didier Eribon bis Maggie Nelson, von Annie Ernaux bis Paul B. Preciado, von Karl Ove Knausgard bis Rachel Cusk – nämlich eines, das nicht erkennbar an ein zeitgenössisches Leben gebunden ist, das mit den Leser*innen auf demselben Planeten und zur selben Zeit stattfindet. Der lakonische Gestus des Erzählers, das immer als Spannung ausgespielte, gleichzeitige Zu-viel- und Zu-wenig-Wissen der Protagonist*innen, die ungeduldigen Überfliegereien und die ungerührten Scheußlichkeitsprotokolle taugen nicht zum empathiebedürftigen Berichten von Transformationen und existenziellen, persönlich erfahrenen Veränderungen und auch deren Scheitern, zu deren Darstellung literarisches Schreiben gegenwärtig so gut geeignet zu sein scheint. Die Sprünge, die Perspektivwechsel, (oft angetäuschten) Vielstimmigkeiten wollen etwas ganz anderes. Während dieser Unterschied vielleicht naheliegender damit bestimmt wäre, dass es sich bei Bolaños Schreiben eben um eine ganz andere Art von Literatur handelt – ich sage gleich, welche –, drängt sich mir aber ein anderer Verdacht auf, den ich schon lange hege: Tote Autor*innen schreiben anders als Lebende. Ich würde sagen: besser.
Warum überhaupt die Autofiktion als Kontrastfolie? Nun, zum einen stellt sie eine literarische Bewegung oder Kategorie dar, der sich diese Kunstzeitschrift vor kurzer Zeit gewidmet hat; sie interessiert mich, weil ich in ihr den neusten Versuch der geschriebenen Kunst sehe, etwas Indexikalität in die Symbole reinzutreiben – ein fast schon tragisch medienkompetitives Unterfangen, gegen das trotz seiner Aussichtslosigkeit (im zeichenontologischen Sinne) gar nicht so viel zu sagen wäre (es ist anderweitig produktiv wie so viele Attacken auf Windmühlenflügel). Zum anderen aber hat Heinrich von Berenberg, mit Christian Hansen einer der beiden hochverdienstvollen Hauptübersetzer des Autors, in einem Nachwort für Cowboygräber, den neusten, frisch von der Festplatte des Verstorbenen gekratzten Erzählungsband, das Autobiografische an diesem Werk nicht ganz unplausibel hervorgehoben. Wenn es das aber ist, autobiografisch, wieso ist es das auf so andere Weise als die kurrente Autofiktion, die ja zumindest eines mit Bolaño gemeinsam hat: das Zusammengesetzte aus Auto und Fiktion (eine Bestimmung, die so nackt und lapidar allerdings immer schon unter Banalitätsverdacht gestanden hat)?
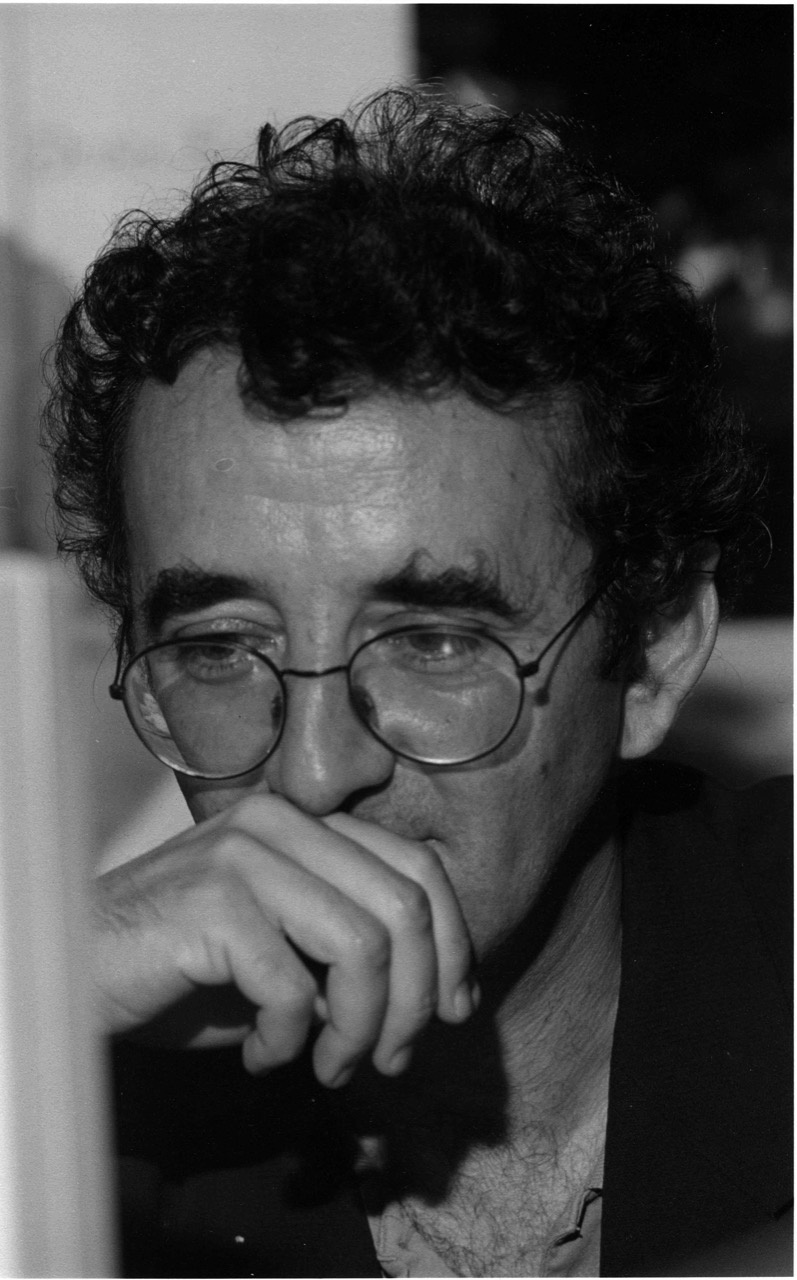
Roberto Bolaño
Und hier kommt die „ganz andere Art der Literatur“ ins Spiel. Klar, Bolaño stammt aus einer anderen, weniger nachdenklich beschwerten, weniger vorsichtigen und aporetischen und deutlich enthusiastischeren Zeit, ist ein Kind von Gegenkultur, Exil, 70er-Jahre-Beatnik-Rezeption; darüber hinaus haben ihn spezifisch lateinamerikanische intellektuelle Traditionen (konzeptuelles Erzählen, die Linie Macedonio Fernández – Borges – Cortázar, aber auch die politischen Chilenen von Nicanor Parra bis Pedro Lemebel) geprägt, aber auch die kulturelle Grundsatzentscheidung Lateinamerikas, wenn nicht der gesamten spanischsprachigen Welt, dass poesía als eine antirationale, aber linke und politisierte Lebensform zu gelten habe: eine politische Romantik gegen die Innerlichkeitsromantik des Nordens, gewissermaßen der historische Sensibilitätskompromiss zwischen indigenen Kulturen und den Gegenkulturen der Kolonialistenkinder. Belesenheit ist nicht nerdy, aber auch nicht tief, sondern erfahrungsgesättigt, lebendig, abgründig komisch, zum Brüllen tragisch. Und so tritt Bolaño als virtuoser, cooler Meister lakonischer Überraschungen auf, serviert kokett dicke Deadpan-Pointen und wird zum großen Konstrukteur, der über das Können und die Traute verfügt, sich mitten im Dickicht selbstverschuldet schwieriger Ideen und Konfrontationen mit der poetischen Machete einen einfachen Pfad zu bahnen. Weil seine Bücher zu allem Überfluss auch noch wahnsinnig unterhaltsam sind, hat man ihn mit Tarantino und der Entdeckung eines spannungsreichen nicht linearen Erzählens im Herzen der Kulturindustrie in Verbindung gebracht. Seine teilweise forciert drastischen und dann wieder ernsten politischen Schilderungen wurden oft mit Skepsis aufgenommen, weil sich das alles so süffig lesen ließ. Wie frivol ist das denn?
Mit anderen Worten: Diese ganz andere Literatur einer anderen Zeit ist trotz (und ein bisschen auch wegen) aller linker (und postkolonialer) Credentials auch genealogisch verdächtig, nämlich: direkt aus einer alten Männer- und Abenteuerliteratur abzustammen, die eine Subjektivität feiert und fortsetzt, die die transformativen autofiktionalen Erzählungen abzustreifen oder durch etwas anderes zu ersetzen versuchen. Mein Gegenargument: Genau dies ist auch schon ein Teil von Bolaños Projekt. Der expliziten Berufung auf abenteuerliche, umherschweifende, situationistische heterosexuelle Jungs und ihre Organisationsformen – auch in der neuen Sammlung gibt es wieder eine globale surrealistische Untergrundarmee – steht ein gewaltiges Dementi entgegen. Die untergründig verknüpften weltumspannenden Bewegungen sind kein Medium männlicher Souveränität und zu bestehender Abenteuer: Sie sind das Gegenteil, die Form des Souveränitätsverlusts, der Triumph der Poesie in der Organisation unübersichtlicher globaler Netzwerke des Verlorengehens, Abhandenkommens, unerkannter Wiederholungszwänge und von Wirkungen, die die Akteure nie beabsichtigt hatten und die sie zu Verwandlungen zwingen. Das ist zwar romantisch, im Sinne der poesía, aber nicht abenteuerlich, denn hier wird nichts bestanden; alles geht verloren, wenn nicht in Hingabe, dann in Lächerlichkeit.
Das Movens ist Passivität. Dass die Protagonist*innen meist nicht richtig wissen, wie sie irgendwo hingeraten sind, wie ihnen dort gerade geschieht, ist manchmal kokett, aber eben auch stets sweet. Die literaturgeschichtliche Großgestalt Rimbaud etwa ist das Ergebnis einer Art Vergewaltigung durch französische Soldaten, die in Mexiko gekämpft hatten und in ihrer Niederlage von mexikanischer Otherness geimpft wurden, die sie ungeahnt auf den jungen Dichter übertragen, als sie ihn marodierenderweise im Jahr der Pariser Kommune auf dem Weg nach Paris treffen. Literaturwissenschaftler Amalfitano muss (bei seinem zweiten Auftreten) schwul werden, was er aber erst richtig ausleben kann, als er in Mexiko einen Maler kennenlernt, der Larry Rivers kopiert. Nun kann er selbst Frank O’Hara imitieren und so die große romantische Beziehung aus der New York School reenacten. Längst erledigte Kunst- und Literaturgeschichte zu verkörpern, als Fans – das ist bei Bolaño das Schicksal seiner „romantischen Hunde“. Nur so können sie sinnvoll leben – indem sie sich von denen, die Weltgeschichte erlitten haben, gewissermaßen ficken lassen oder indem sie bereits Erprobtes, zur Anekdote Geronnenes mit heißen Herzen durchziehen. Nicht umsonst sind es immer wieder Rechercheformate, die seine Protagonist*innen erleben: als Literaturwissenschaftler*innen, als Oral-History-Forscher, Sportreporter, Mordkommission oder als Fanboys auf der Suche nach mythischen Dichter*innen.
Die unübertroffen lässige Art, mit der diese Souveränitätsverluste erzählt werden, obendrein in einem Verschiebebahnhof der Formate zusammenrangiert, wo sich Schelm, Abenteurer, Dichterin, Fascho, Zuhälter, Kommunistin und Borges-Figur transgenerisch tummeln, treibt natürlich doch wieder eine Sicherheit und Setzung in die Texte, die man bei live erzählten Transformationsautofiktionen nicht so hat. Diese lässige Art kommt schon von ihrer rhetorischen Natur her als Stärke rüber. Dass ein Toter diese Setzung vorgenommen hat, gibt ihr das Endgültige, das alle Liveliteratur nicht hat. Mit Knausgard und Maggie Nelson geht es ja irgendwie weiter. Dass die Sätze Bolaños eines Tages die Sätze eines Toten sein würden, tragen sie in ihrer Form vor sich her. Doch nun sind aber Aktenschränke und Hard Disks überfüllt von Versionen dieser Sätze. Es gibt nicht nur neue Romane sonder Zahl, sondern unzählige Spin-offs: Figuren, die man schon kennt, tauchen leicht abgewandelt erneut auf, Ereignisse nehmen ihren Lauf und dann doch einen anderen. Bei den drei Erzählungen der Cowboygräber sehen wir zahlreiches Personal wieder: vom faschistischen chilenischen Militärkunstflieger und Himmelschreiber Carlos Wieder (nomen est …) bis zum sogenannten Wurm, El Gusano, der schon einmal eine fast wortgleiche eigene Geschichte hatte. Es gibt wieder einen Belano, diesmal Rigoberto, und in der dritten Geschichte taucht schließlich ein guayanisches Alter Ego des wilden Detektivs auf, das von einer fast anagrammatischen Version von Édouard Glissant beeinflusst ist (Regis St. Clair). Das vervollständigt das Repertoire postkolonialer Intellektueller im Œuvre und schließt letzte Lücken.
Manche Geschichten gehen zwar nicht zu Ende oder springen wilder hin und her, als es der Autor beabsichtigt haben dürfte. Aber auch diese Entscheidungen sind in ihrer verschmitzten Apodiktik so charmant wie unumstößlich. Jeder Satz ist so gültig wie das berühmte letzte Wort. Redigiert wird nicht. Ein Traum. Und doch gibt es auf der Festplatte der letzten Worte Hoffnung und Versöhnung: Wer in einer Version lapidar im Irrenhaus verschwindet, kommt in der nächsten tragisch ums Leben, die Todgeweihte aus der anderen Novelle, erfreut sich nun eines langen Lebens. Die letzten endgültigen Worte bleiben nur in der Form endgültig; der immer noch unfassbare Verlust des viel zu jung Verstorbenen wird von dessen posthumer Produktivität kompensiert – ohne dass man sich fragen muss: Was macht der eigentlich, hat der nicht gerade etwas Dummes unterschrieben, einen peinlichen Preis angenommen, einen debilen Diktator verteidigt, auf Twitter genöhlt oder sich über Cancel Culture aufgeregt? Macht der alles nicht.
Roberto Bolaño, Cowboygräber: Drei Erzählungen, München: Hanser Verlag, 2020.
Diedrich Diederichsen ist freier Autor und lehrt an der Akademie der bildenden Künste Wien.
Image credit: 1. Copyright Carl Hanser Verlag; 2. The Estate of Roberto Bolaño
