Stimmen hören Über das Lesen und Aufführen von Poetry

Young Girl Reading Group #113, Ausstellungsraum Klingental, Basel, 2016
Ein Rezeptionsmodus, der unsere Auseinandersetzung mit künstlerischer Textproduktion in dieser Ausgabe immer wieder durchzieht, ist der des Gelesen-Werdens: eine Perspektive, die die Bedeutung von Formen des „Teilens“ und Veröffentlichens für die Autorschaft selbst betont.
Nicht zufällig erscheint es da, dass Karolin -Meuniers einleitendes Beispiel „How to disappear“ des in Berlin lebenden Autors Haytham El-Wardany auch an Seth Prices Buch „How to disappear in America“ erinnert; während Letzteres das Verschwinden des Autors in den Textformen des Internets protokolliert, geraten bei El-Wardany, in Meuniers Lesart, auch schon beim leisen oder lauten Lesen eines Textes die Grenzen des Selbst und die Ideen von Besitz – auch der eigenen Stimme – in Bewegung.
Ein Text schlägt immer auch seine eigene Aufführung im Gelesen-Werden vor und damit die Möglichkeit seiner Aktualisierung und Enteignung. Wenn man das Schreiben unter der Perspektive des Lesens betrachtet, ist die Stimme das unberechenbarste Element. Sie ist performativ, sie schreibt den Text neu, sie stellt eine Gegenwart her und verhält sich damit zugleich produktiv und distanziert zur Zeit des Geschriebenen. Das gilt auch für jedes lautlose Lesen. [1] Viele jüngere Autorinnen, wie etwa Hannah Black, Hanne Lippard oder auch Ruth Buchanan, reagieren mit ihrer literarisch-künstlerischen Praxis auf das Spannungsverhältnis zwischen einem konstanten, sich lautlos abrollenden, ständig erneuernden Textfluss auf Bildschirmen, Ausstellungsdisplays und in Publikationen und dem Bedürfnis nach temporären Zusammenkünften, nach einem Ausagieren und Verdichten von Text im Sprechen. Die zu beobachtenden Verknüpfungen von poetry und Performance – mit all den popkulturellen, aktivistischen und akademischen Facetten, die der Liveauftritt bereithält – sind dennoch nicht nur symptomatisch für eine Tendenz zu mehr Unmittelbarkeit, weder im Sinne von Flüchtigkeit noch von Authentizität. Vielmehr stellt sich die Frage nach einem Umgang mit den zeitgenössischen Inszenierungen von Sprache ebenso wie von Subjektivität, und das in kritischem Bezug auf die Rolle von Zuschauern/Zuschauerinnen und Lesern/Leserinnen, deren Teilhabe in einer nicht passiven und dennoch von der Aufführung getrennten Perspektive der Rezeption besteht.
Der aus Kairo stammende und seit den 1990ern in Berlin lebende Autor Haytham El-Wardany schreibt seine Kurzgeschichten und Prosatexte zunächst in Arabisch. In den letzten Jahren sind seine Arbeiten vermehrt übersetzt und im Kunstkontext gezeigt worden, was sicher auch an deren Konzeptualität liegt und am Interesse des Autors an einem Schreiben, das sein Terrain verlässt. In „How to Disappear“, eine als Handlungsanweisung verfasste Untersuchung des Auditiven, schreibt er von der beim Lesen aktiven, wenn auch nicht hörbaren Stimme, dass sie weder mit dem Klang des eigenen Sprechens noch mit der allgemeinen „Stimme der Geschichte oder der Wahrheit oder einer der Autor/innen“ [2] vergleichbar sei. Er fordert zu einer Reihe von Übungen auf („In the third session, read what you like of poetry. Let it be the work of Salah Abdel-Sabur“) und entwickelt darüber den Gedanken, dieses gleichsam zeit- und körperlose innere Lesen nicht als bloß kontemplative und selbstimmanente Geste zu verstehen, die den je spezifischen Kontext und Tonfall eines Textes für sich vereinnahmt. Auch die eigene Stimme ist kein Besitz, aus dem heraus oder in den hinein sich die Texte anderer rezipieren lassen; sie wird vielmehr zur Voraussetzung für die temporäre Auflösung einer geordneten Subjektivität: „This means that […] the voice in which the self declares its presence, bespeaks ideas, emotions, and memories not specific to you but rather to the author. […] Contemplate the fact that your inner voice, at this moment, is nothing more than the voices of others that have become part of you.“ Diese Theorie der Durchlässigkeit wird im zweiten, narrativen Teil seines Buches, „Sounds of the Middle Classes“ noch stärker als politisches Anliegen kenntlich gemacht: Es geht um Lärm und um Rückzug, um Teilhabe an und Ausschluss von den Klängen der Stadt und um Praktiken der Deregulierung. Mit seinem Essay lassen sich die Möglichkeiten, aber auch die Fragilität einer offenen Struktur von Stimme, Person und Text skizzieren. Das Lesen erscheint dabei wie eine Art Distributionsmodell, dessen Qualität in der performativen Überlagerung verschiedener Perspektiven liegt. Wer in welchem Kontext schließlich gehört wird, bleibt jedoch Ausdruck gesellschaftlich bedingter Grenzziehungen.
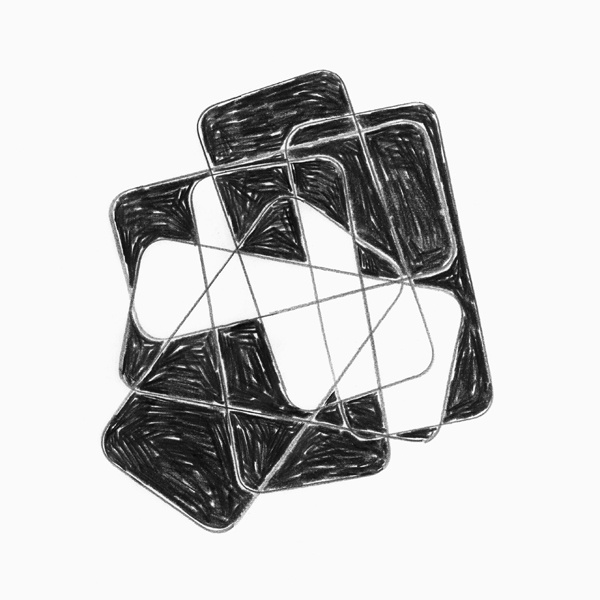
Henriette Heise, "iPhone 5 Matter,“ 2013/14
Auf der diesjährigen Berlinale im Forum Expanded, der künstlerischen Sektion des Filmfestivals [3] , war Haytham El-Wardany zu einer Lesung aus „The Hanging Garden of Sleep“, seiner aktuellen poetischen Untersuchung des Schlafs als Form des Entzugs und der Veränderung, eingeladen. Die Veranstaltung fand nicht im diskursiven Rahmenprogramm des Festivals, sondern im Kino statt, zwischen zwei Kurzfilmen. Der Text wurde im Original gelesen, auf der Leinwand war die englische Übersetzung eingeblendet. Stärker noch als dies bei untertitelten Filmen der Fall ist, mag der nicht Arabisch sprechende Teil der Zuhörenden dem für sie abstrakten Klang der Worte gefolgt sein. Und das Kino wurde zu einem jener öffentlichen Räume, in denen, wie es in „The Hanging Garden of Sleep“ heißt, sich die Schlafenden den sozialen Aktivitäten der Gemeinschaft entziehen und zugleich „ein Vertrauen in den zufälligen anderen“ [4] beweisen.
Wenn zurzeit viel vorgelesen wird, im Rahmen von Ausstellungen, Künstlerbuchmessen und selbst organisierten Veranstaltungen, geht es – abgesehen von deren Platz in der Ökonomie aktueller Eventkultur – vielleicht auch um ein ähnliches Moment, das produktive Risiko im wechselseitigen Sich-Übereignen an den anderen. Dabei fallen vor allem solche Positionen auf, bei denen die Person und ihre Sprache gerade nicht in eins fallen, die etwas anderes vorschlagen, als der Verlebendigung eines gedruckten Textes durch dessen Autor/in zuzusehen. Der Fokus auf die Situation des Vorlesens und Gelesen-Werdens und deren jeweilige Bedingungen ist zugleich Hinweis auf die Konstruiertheit des bereits Geschriebenen wie auf dessen Veränderbarkeit. Mit der den Text interpretierenden Stimme wird ein Moment gemeinsamer körperlicher Anwesenheit offensichtlich, gleichzeitig oder zeitlich versetzt und stellt eine Verbindung her zur Situation des Schreibens, das unter anderen Bedingungen und doch auf ein zukünftiges, nicht planbares Publikum hin geschieht. Auch innerhalb der Literatur selbst lässt sich diese Entwicklung an Gedichten und Prosatexten festmachen, die die Idee von der Vorläufigkeit und Gemachtheit des Geschriebenen in sich tragen, also den Bruch in und mit der Sprache in Form des abgeschlossenen Textes selbst aufführen und damit ebenfalls eine weitere ästhetische Diskussion dieser Form eröffnen. [5]
Einer der außerinstitutionellen Zusammenhänge in Berlin, in dem mit der Aufführung literarischer Formate experimentiert wird, ist die Veranstaltungsreihe „After the Eclipse“ [6] , organisiert von Ebba Fransén Waldhör, Imri Kahn und Sarah M. Harrison, bei der meist mehrere Autoren/Autorinnen hintereinander kürzere Texte präsentieren. Manche der Arbeiten entstehen für diesen Anlass oder werden hier zum ersten Mal veröffentlicht, abgelesen von Laptops, Handys und Ausdrucken. Die Lesenden sind auch Zuhörende, und es scheint nicht unbedingt um fertige Bücher oder ein kuratorisches Programm zu gehen, eher vermittelt sich ein commitment zur gemeinsam geteilten Öffentlichkeit und das Bedürfnis, diese selbst zu bestimmen. Sarah Harrison, selbst Autorin, hat Anfang dieses Jahres eine Novelle veröffentlicht. Deren Protagonisten und Protagonistinnen scheinen keiner bestimmten Szene zugehörig, und auf ihren Wegen durch eine westliche Metropole strahlen sie eine bohemistische, slackerhafte Lässigkeit aus. Der Tonfall ist auf ungewöhnliche Weise negativ, doch werden die Figuren nicht psychologisiert oder bewertet. Wie in anderen Arbeiten Sarah Harrisons zerfallen ihre Dialoge und Innenperspektiven immer wieder in zersprengte Sätze, mal rant, mal Konkrete Poesie des Profanen.
„All the Things“, so der Titel, ist erschienen bei Arcadia Missa, einem Verlags- und Ausstellungskollektiv in London, das auch Hannah Blacks Anthologie „Dark Pool Party“ mitherausgebracht hat. [7] Beide Bücher sind auf unterschiedliche Weise schnell; sie geben ein Tempo vor, das auch der Virtuosität geschuldet ist, mit der die Autorinnen Alltagssprache verarbeiten, als geschärftes Echo an ihre Leser/innen zurückschicken – und mit einer in diesem Sinne kollektivierten Stimme der Frage nach der Aneignung des Persönlichen durch die Leser/innenschaft einen gewissen Widerstand entgegensetzen. In Hannah Blacks Schreiben gilt das ebenso für das Vokabular akademischer und kunstkritischer Diskurse und den darin sich manifestierenden Hierarchien. Indem sie sich mit literarischen Mitteln in eine begriffliche Nähe dazu begibt, verhandelt sie auch die Parameter, unter denen bestimmte Konflikte diskutiert werden, nicht zuletzt den häufig beispielhaften Charakter künstlerischer Positionen in kuratorischen und theoretischen Konzepten. So wird etwa in dem kurzen Text „Atlantis“ die Analogie, als rhetorisches Stilmittel poetischer Arbeitsweisen so selbstverständlich wie unentbehrlich, von ihr politisiert und deren Einsatz verkompliziert. Wenn eine Sache immer auch für eine andere stehen kann, setzt das potenziell eine endlose Kette von Vergleichen in Gang, mit der spezifische Erfahrungen exemplarisch gemacht, verschleiert oder von Bedeutung entleert werden. „This is in spite of the category’s obvious problems: being made an example of, becoming fungible. […] It is not that I think we are tasked with imagining or hypothizing another world; it sits on this world’s shoulder; it is its parrot, its angel, but metaphors are banned in the war on analogys, too. I think that blackness and maybe also labor, through the enslaved person as well as the worker, hover in this banned limbo.“
„Dark Pool Party“ ist eine Sammlung kürzerer Formate, die einer zwischen poetischer, persönlicher und analytischer Sprache aufgespannten losen Narration folgen, hier die Einladung zu einer Gruppenausstellung in „Atlantis“ als kontextloser kuratorischer Ideenwelt, in der die Darstellung realer Krisen sich zugunsten „globaler und identischer Formen“ in wirkungslose Vergleiche verschiebt. Die Analogie ist dabei kein Ersatz für einen anderen Schauplatz. Der Angriff gilt der Sprache als Instrument eines weißen und vor allem männlichen Abstraktionsanspruchs.

After the Eclipse, Flutgraben e.V., Berlin, 2015
Viele von Hannah Blacks Texten entstehen für den Kontext, in dem sie live gelesen werden, wie bei „After the Eclipse“, oder im Livestream übertragen, wie zuletzt im Performance-Programm des Festivals „What time is it on the clock of the world*“ [8] in der Hamburger Innenstadt. Die Schnelligkeit und der eigene, musikalische Rhythmus, in dem die Texte von der Autorin performt werden, machen deren kompositorische Qualität gerade in ihrem Bezug zur gesprochenen Sprache erkennbar. Es ist eine Form der Unabgeschlossenheit bei gleichzeitiger Präsenz, die das Publikum nicht so leicht aus der Verantwortung einer aktiven Zuhörerschaft entlässt.
Das Geschriebene einem Zustand der Beweglichkeit auszusetzen, der sonst dem Sprechen und der Improvisation eigen ist, und damit auf einer Offenheit zu bestehen, die von Zufällen ebenso bestimmt wird wie von der Dringlichkeit des Gesagten und dessen Effekten, ist sicher eines der Anliegen, das sich mit dem Begehren nach „Text“ und dessen Performance in der zeitgenössischen Kunst verbindet. In einer Sprache zu sprechen, die ein Großteil des Publikums oder der Performer selbst kaum versteht, etwas mehrmals, sehr schnell oder sehr langsam zu lesen oder durch technische Geräte verzögert, sind mögliche formale Spielarten, die zugleich Trennungen markieren. Sie vermitteln die unbeständigen und verletzlichen [9] Verknüpfungen von Person, Stimme und Text im Verhältnis zum Publikum.
Ian White hat mit seiner Praxis als Autor, Künstler, Filmkurator und in der Lehre immer auf der Bedeutung des Gegenwärtigen bestanden und dies auch diskutiert. [10] In einem Gespräch, das 2011 anlässlich einer Performancereihe im Kunsthaus Bregenz mit den beteiligten Künstlern und Künstlerinnen geführt wurde, hat Ian White den Begriff der „provisorischen Gemeinschaft“ ins Spiel gebracht, die nicht nur am Moment der Wiedergabe, sondern auch an der Produktion einer Arbeit beteiligt ist: „Für mich passiert das Machen auch live, im Ereignis selbst. So denke ich nicht, dass der Live-Moment allein die Veröffentlichung oder Präsentation von etwas bereits Gemachtem ist. […] Die Bedeutung der Arbeit ist zum Teil abhängig von der Art und Weise wie sie geteilt wird.“ [11] In der Vielzahl von Entscheidungen, die im Augenblick der Aufführung getroffen werden, liegt ein Moment der Aktualisierung, das nicht immer gelingen und nicht immer angenehm sein muss. Denn den Betrachtern/Betrachterinnen vermittelt sich nicht nur eine Erfahrung produktiver Teilhabe, sondern zugleich auch der Entzug von Präsenz, das Getrennt-Sein von dem, was sich abspielt. Es ist diese Spannung, in der „sich das Provisorische akkumulieren kann“, wie Emma Hedditch im gleichen Gespräch vorgeschlagen hat; und dadurch den Performenden/die Performende in die Lage versetzt, „einen temporären Moment zu haben, der von den Leuten auch als temporär verstanden wird“. [12] Künstler wie Künstlerinnen haben in ihren Arbeiten die Sprache häufig an den Rand des Unverständlichen gedrängt, etwa durch eine die Stimme überlagernde Geräuschkulisse und eine den Text überlagernde Bildebene in einigen von Ian Whites Performances oder durch Emma Hedditchs Praxis der Kollektivierung und Anonymisierung der Sprecher- bzw. Sprecherinnenposition. Zugleich sind dies keine Strategien der Verrätselung, sondern sie provozieren eine Poetik der Aufmerksamkeit für spezifische Situationen: für die Hierarchien zwischen denen, die sprechen, und denen, die zuhören, für Körperhaltungen und Raumaufteilungen, für die Einladungspolitiken von Institutionen und Freundeskreisen, für die Gefühle, die dabei entstehen, und die unterschiedlichen Erfahrungen und Möglichkeiten in dieser provisorischen Gemeinschaft, die auch davon abhängen, welche kulturellen und geschlechtlichen Zuordnungen offen oder verdeckt vorgenommen werden. – „The image, description brings force, recognition. Free excitement, a coinciding with themselves. Not the way of looking or how they look, with an in-built mechanism of understanding codes signs or familiarity. The image description a reading, imagining image. The image of our being near to each other is just an image. It is however generative, trusting a signal.“ [13]
Bei den hier genannten künstlerischen Positionen ist die Perspektive, aus der heraus gesprochen wird, häufig eine, die zugleich adressiert; sie ist persönlich, aber nicht in einer Weise mit sich identisch, als dass sie sich einzig mit den Erfahrungen der Autoren/Autorinnen verbinden und damit von den Zuhörenden abspalten ließe. Sie ist vielmehr auf diese im Sinne einer Auseinandersetzung bezogen. Darin zeigt sich vielleicht auch eine Reaktion auf die Krise der first person narratives oder zumindest der Bedarf für deren Neujustierung, entgegen der Logik eines bloß narzisstischen, ahistorisierenden Besitzes an der eigenen Geschichte sowie deren Aneignung als Anschauungsmaterial durch andere. Hannah Black etwa beschreibt in ihrem Artikel „The Identity Artist and the Identity Critic“ sehr genau die widersprüchlichen Implikationen von identitätspolitischer Argumentation: „This form of identity politics affords no materiality to history (which is a word for collective experience) beyond the narrow boundaries of the self.“ [14]
In vielen zeitgenössischen Positionen verweist der Einsatz der „ersten Person“ jedoch nicht mehr nur auf ein das Gesagte subjektivierendes und damit legitimierendes „Ich“, wie es vor allem feministische Schreibweisen etabliert haben, oder auf ein in seiner Metaphorik sich auflösendes „lyrisches Ich“. Wenn die Autoren/Autorinnen gerade in der Inszenierung des Textes anwesend sind, verbirgt sich in den sicht- und hörbaren Differenzen von Text und Sprecher/in auch ein anderer Handlungsspielraum. In der Präsenz liegt zwar die Möglichkeit der Fetischisierung der Lesenden, doch ebenso die Materialisierung der Performance wie des Textes, die in die künstlerische Arbeit miteinbezogen sind. Denn das Wissen um die potenzielle Austauschbarkeit von Pronomen wie der sie aufführenden Person provoziert Präsentationsformen, die diese Prozesse verkomplizieren, wenn die lesende Stimme auf der Gegenwärtigkeit der konkreten Situation insistiert, wie provisorisch auch immer.
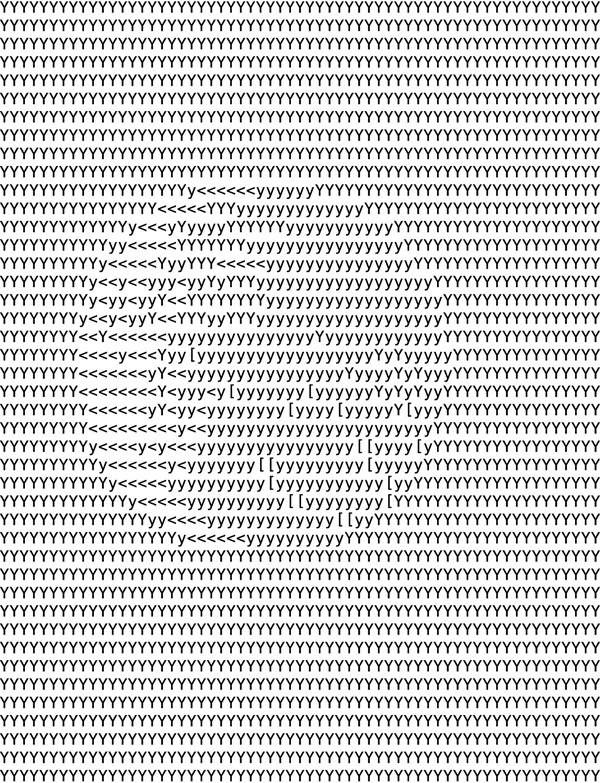
Ebba Fransén Waldhör, untitled, 2016. (illustration for Hanna Black‘s "Dark Pool Party,“ 2016)
Anmerkungen
| [1] | Zum Verhältnis von Lesen und Gelesen-Werden siehe auch die Besprechung von Eva Meyers Buch „Legende sein“ in dieser Ausgabe. |
| [2] | Alle Zitate: Haytham El-Wardany, How to Disappear, a. d. Arabischen von Jennifer Peterson, Beirut/Zagreb 2013. Das Buch ist der erste Teil einer Reihe von How-to-Manuals, hg. von Maha Maamoun/Ala Younis bei Kayfa ta. |
| [3] | Das Forum Expanded wird kuratiert von Stefanie Schulte- Strathaus/Anselm Franke/Nanna Heidenreich/Bettina Steinbrügge/Ulrich Ziemons. |
| [4] | Haytham El-Wardany, „The Hanging Garden of Sleep“, in Starship, 14, 2016 |
| [5] | Zum Beispiel Autorinnen wie Monika Rinck mit ihrem Gedichtband „Honigprotokolle. Sieben Skizzen zu Gedichten, die sehr gut sind“, Berlin 2012, in dem immer wieder gleiche oder ähnliche Satzanfänge und Wortketten aufgegriffen werden; oder Anne Boyers mit dem Gedicht „Questions for Poets“, das nur aus Fragen besteht und einem umfangreichen Fußnotenteil, in: „Anguish Language. Writing and Crisis“, hg. von John Cunningham/Anthony Iles/Mira Mattar/Marina Vishmidt, Berlin 2015. |
| [6] | Die Veranstaltungen finden in den Räumen des Flutgraben e.V. in Berlin statt. |
| [7] | Sarah M. Harrison, „All the Things“, London 2016, und Hannah Black, „Dark Pool Party“, London 2016 |
| [8] | „What Time Is It on the Clock of the World*“, Internatio-nales Festival zu Feminismus und öffentlichem Raum, kuratiert von Sophie Goltz, Stadtkuratorin Hamburg, Mai 2016. |
| [9] | Das Begriffspaar ist einem Gesprächsbeitrag der Künstlerin Ruth Buchanan entnommen, in dem sie von den „verletzlichen oder unbeständigen Konsequenzen“ der Spannung zwischen dem Provisorischen und dem Spezifischen spricht. Vgl.: On Performance, hg. von Eva Birkenstock/Yilmaz Dziewior/Joerg Franzbecker, Bregenz 2012. |
| [10] | Seine Haltung prägt auch nach seinem zu frühen Tod das Verständnis vieler, die mit ihm gearbeitet und Zeit verbracht haben. Eine Sammlung seiner Schriften wird im Oktober diesen Jahres unter dem Titel Here is information. Mobilise – Selected Writings von LUX in London herausgegeben. |
| [11] | Das nicht öffentliche Gespräch zwischen fast allen beteiligten Künstlern/Künstlerinnen und den Kuratoren/-Kuratorinnen Eva Birkenstock und Joerg Franzbecker wurde nachträglich und im Hinblick auf die Publikation geführt. Vgl.: On Performance, a. a. O.. |
| [12] | Ebd. |
| [13] | Ausschnitt eines Gedichts von Emma Hedditch, das die Autorin 2015 per E-Mail mit der Betreffzeile „We Are the Signs and the Signals“ an eine unbekannte Anzahl von Personen verschickt hat. In ihrem in diesem Jahr erschienenen E-Book „I Don’t Want You To Work As Me“ findet sich ein Performanceskript mit dem gleichen Titel. |
| [14] | Hannah Black, „The Identity Artist and the Identity Critic“, in: Artforum, Sommer 2016. |
