META-AUTORITÄT Liola Mattheis über „Authority“ von Andrea Long Chu

„Yellowjackets“, 2021
Bevor Andrea Long Chu zur berüchtigten Kritikerin avancierte, machte sie mit einem Eingeständnis der eigenen Kriterienlosigkeit auf sich aufmerksam: „The truth is, I have never been able to differentiate liking women from wanting to be like them“ (65) lautet der Slogan eines 2018 erstmals veröffentlichten Essays, dessen scharfzüngige Engführung von (Trans-)Geschlechtlichkeit und Begehren weiterhin die Gemüter erhitzt. Chus Texte drängen seitdem kontinuierlich gegen feministische Politiken, die Entzüge des Begehrens verleugnen, von stabilen Geschlechtsidentitäten ausgehen und auf Respektabilität abzielen. Stattdessen geht es ihr um die Annäherung an eine Politik „with a hole in it – a pink universal“. [1] Die Form, in der sie zunächst auf diese hinschreibt, ist ein Hybrid von Theoriepolemik und pointierten Memoiren.
„On Liking Women“ und andere Essays, die Chu in den folgenden Jahren veröffentlicht hat, sind nun erstmals in Buchform erhältlich. Unter dem Titel Authority versammelt die Pulitzer-Preisträgerin – mit gerade mal Anfang 30 – ihr Frühwerk (ihre „juvenilia“, x). Allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Nicht dabei sind ihre in akademischen Journals publizierten Beiträge zu den Trans Studies, einem Feld, dem sie bescheinigt hatte, over zu sein oder zumindest sein zu sollen. [2] Auch Chus unverkennbare Tweets – die wohl einen integralen Bestandteil ihres Korpus darstellen – sucht man vergeblich. Dafür finden sich im Band neben den vor allem bei n+1 erschienenen Essays die hinter mancher Paywall hervorgeholten Popkulturrezensionen, die sie zunächst als Freelancerin und später als Redakteurin beim New York Magazine verfasste. Neben den ohne Überarbeitung und nur gelegentlich mit einem Postskript wiederveröffentlichten Texten liefert der Band auch zwei neue Essays („Criticism in a Crisis“ und „Authority“), die eine Metareflexion zum Nexus von Autorität und Kritik anbieten – und von höchst unterschiedlicher Qualität sind.

Alex Norris, „Webcomic Name“, 2021
Wenn ihre frühen Essays thematisch vorrangig von Begehren und Enttäuschung umgetrieben sind (ix), so zieht sich die Aufmerksamkeit für Libidinöses und seine Negativität auch in diejenigen Texte hinein, wo Chus Gesellschaftskritik dezidiert an kulturellen Objekten ansetzt. Von den TV-Serien Yellowjackets und Yellowstone über Hanya Yanagiharas Roman A Little Life zur zeitgenössischen Rezeption von Octavia Butlers Erzählung Bloodchild sind ihre Objekte vielfältig; sie ergeben ein Tableau der Mainstreamkultur unter Donald Trump und Joe Biden. Chus Paradedisziplin: süffisante Verrisse. Besonders vergnüglich ist die Lektüre, wenn Joey Soloway, bekannt für die Serie Transparent, vorgeworfen wird, in deren Memoiren Metaphern zu mischen „like a bartender in a recoding studio“. (136) Oder wenn der scheue Erzähler in Tao Lins Leave Society als „also a hypochiandric of ideas“ diagnostiziert wird: „that is, he often thinks he has them.“ (222) Chu ist weder paranoide noch reparative, sondern zuallererst provokante Leserin. [3] Anstelle einer Hermeneutik des Verdachts, die politischen Fehlern ihres Rezensionsobjekts auf die Schliche zu kommen meint, oder eines Versprechens der Heilung wunder Widersprüche, bestechen ihre Lektüren durch aufreizende Herausforderungen – der diskutierten Objekte und allen voran der Leser*innen. Doch es ist ein Vorurteil, dass ihre Provokation stets apolitischem Tabubruch gleichkäme. [4] Sicherlich hat Chu wenig Geduld für regulierte Korrektheit, aber noch weniger Geduld hat sie für anti-woke Agitation; „‚PC culture‘“ sei „a fruit that hangs so low it might as well be a vegetable.“ (147)
Chus Leistung ist es, nachzuweisen, wie langweilige Literatur mit langweiligen Politiken zusammenhängt. Lins „naive prelapsarianism“– die Nostalgie für eine Zeit vor dem vermeintlichen Sündenfall, die Leave Society in ein exotisiertes Hawaii projiziert – entpuppt sich beispielsweise als mit einem stumpfen Verständnis von Autofiktion verbunden (so, als besäße das von der eigenen Erfahrung ausgehende Schreiben eine Unmittelbarkeit, die von der Last interessanter Formgebung freimachte). Chus Einwand gegen Zadie Smiths Liberalismus („Smith envisions the novel as a little liberal machine for making more little liberals“ (246) funktioniert auch qua Narratologie; wenn bei den Leser*innen Empathie mit pluralen Charakteren durch erlebte Rede befördert werden soll, so schwingt in dieser Rede, wie Chu betont, Smiths Stimme unweigerlich mit. Charakteristisch für ihre Lektürepraxis ist neben der Aufmerksamkeit für Politiken des Genres auch das Changieren zwischen Werk und Autor*in. Chu hat das ad hominem zum Prinzip kultiviert. Denn Literatur und Leben sind für sie nicht zu trennen („It is my understanding that persons are where books come from.“ [5] ) (10) So leuchtet sie dann auch humorvoll Übergänge zwischen realen und fiktionalen Figuren aus. American Psycho-Autor und zugegebenermaßen selbst ziemlich low-hanging fruit Brett Easton Ellis zum Beispiel „has come to resemble a [Ottessa] Moshfegh character in recent years: perpetually resentful, laughably unaware of his own irrelevance“. (203) Ja, Chu findet vieles schlecht (wenn auch wahrlich nicht alles, wie zum Beispiel Yellowjackets). Aber nicht einfach so: Sie schreibt an gegen eine von den Abgründen des Begehrens zu bereinigende Politik und ihrem Pendant, einer holzschnittartigen politischen Ästhetik.
„Essays on being right“, der Untertitel des Hörbuchs und der angekündigten Taschenbuchausgabe von Authority, erfasst also gut den Charme ihrer Position: Chu verbindet Antinormativität mit Urteilen – Urteilen darüber, was schlecht ist und was auf gute Weise schlecht ist. Was aber stützt diese Urteile? Im Cocktail, der ihren Aufstieg zum Pulitzer-Thron befeuert hat, mischen sich comp lit- und close reading-Ausbildung in Duke und an der NYU mit den Blütetagen von Twitter, dem „Trans Tipping Point“ und einem boomenden Interesse an Psychoanalyse. Doch jenseits von Chu tun sich auch grundsätzliche Fragen auf: Warum wird von Kritiker*innen ein Urteil ohne klare Begründung akzeptiert, ja erwartet? Und warum sollte man glauben, sie haben recht?
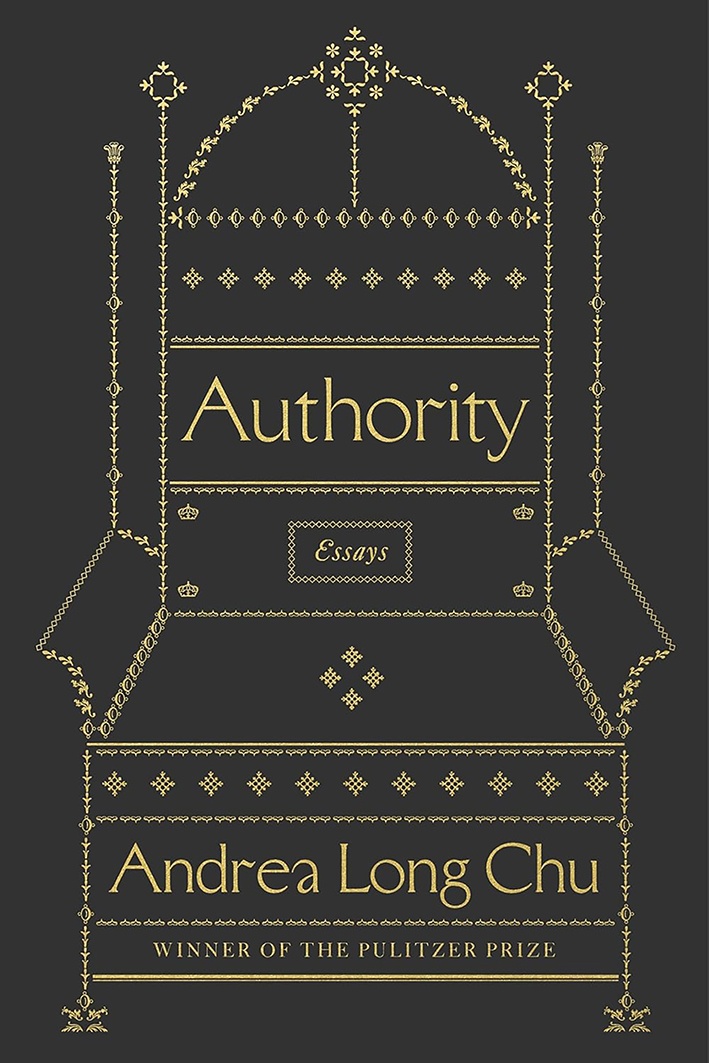
Andrea Long Chu, „Authority“, 2025
Das ist Thema des titelgebenden Aufsatzes „Authority“, einer üppigen, aber schnörkellosen Abhandlung über das normative Fundament von Kritik in der Moderne. Chus Ausgangsbeobachtung ist die einer erschreckenden Leere: Konstitutiv für Kritiker*innen sei, dass sie urteilen, ohne je „decidedly right“ sein zu können (weil es eben keine definitiven Beweise für künstlerische Exzellenz gibt). (170) In dem dadurch notwendigen Moment der Selbstfundierung ähnele die Autorität des*der Kritiker*in der des Königs (also einer „terrifying position of pure authority which in most other cases we so ardently oppose“. (170) So ist Chu wenig überrascht, dass die Frage nach kritischer Autorität historisch in Analogie zum Problem politischer Legitimität diskutiert wurde. Rasche Rekonstruktionen von Martin Luther bis Susan Sontag sollen nahelegen, dass Literatur- und Kunstkritik stets liberaler Herrschaft als Versuchsfeld der Gehorsamkeit diente. In dieser Chu-Story gibt es weitestgehend kein Geschlecht, keinen Sex, kein Begehren, dafür aber die Genremarker langweiliger Ideengeschichte (mitsamt Formulierungen wie „As the nineteenth century drew to a close“ und der obsessiven Identifizierung historischer Paradoxien). (184) Das aufgeregt vorgetragene, ziemlich unaufregende Fazit – im Zuge der Erosion liberaler Demokratie könne Kritik womöglich gerade die Abwesenheit von Autorität erproben – ist unausgegoren und mit Chus eigener Praxis schwer zu vereinbaren. Ihr Schreiben bleibt nicht nur, wie sie selbst einräumt, stilistisch an das Autoritative gebunden; anders als in dem Anarchismus-lite-Vorschlag dieses Essays geht es ihr sonst ja gerade nicht um die absolute Überwindung von Zwängen – „surely the left should try to impose its political values on others; if I’m not mistaken, we call this winning“ [6] (58) – oder von Kräften, die sich der eigenen Kontrolle entziehen, sondern um deren Verschiebung und ein neues Verhältnis zu Negativität.
Was Chu an Maggie Nelsons Essayband bemängelt – dass Fans der Argonauten in On Freedom nur „that book’s inner graduate student, eager to show she has done the reading“ (54) fänden –, ließe sich somit gegen sie selbst wenden. Ihre Aufarbeitung der Kritik bleibt strebsam und generisch. Mehr spicy Einsicht steckt in der kurzen Rezension über einen pinken Cartoon-Klecks (aus Alex Norris’ Webcomic Name), die dem „Authority“-Text vorangeht („Like everyone, the blob is a critic and, like every critic, a con“). (164) Das soll nicht heißen, dass Chu keine spannende Genealogie schreiben könnte. Ihr Versäumnis hier ist es, kritische Theorien nur im Vorbeigehen zu erwähnen [7] und die Frage der Hörigkeit („our longing for authority“ (194)) lediglich anzutippen. Wie Begehren (von Autor*innen wie Leser*innen) die Autorität der Kritik und des Autoritarismus strukturiert, das ist die Untersuchung, die von Chu zu erhoffen gewesen wäre. Was bestimmt die Lust, sich der Autorität einer Kritikerin wie Chu hinzugeben? Was hingegen die, den „Gender Critics“ zu lauschen?
Zum Glück ist der zweite Essay, mit dem Chu im Genre der „polemic“ und „statement of purpose“ (ix) ähnliche Referenzen aus der Geschichte der Literatur- und Kunstkritik bearbeitet, mutiger. Vor dem Hintergrund einer Auftragsrede, die aufgrund der Gaza-Politik des Veranstaltungsortes nach dem 7. Oktober nicht zustande kam, destilliert sie im Aufsatz „Criticism in a Crisis“ Überlegungen zur Komplementarität von Kunst und Kritik. [8] Chu hofft, dass die neue Phase dessen, was sie mit Rashid Khalidi als den hundertjährigen „war on the Palestinian people“ fasst (3), Kritiker*innen zum Weckruf wird – und sie Pseudokrisen von realen Krisen unterscheiden lässt. Die Selbstdiagnose der Krise zeigt Chu als eine, mindestens bis zu Samuel Johnson zurückzuverfolgende, historische Konstante im Metier der Kritiker*in auf (eine Beobachtung, die sie mit der TZK-Ausgabe zu „Reviews“ teilt [9]). Sie arbeitet überzeugend heraus, wie die beständige Krisenrhetorik mit elitärer Hysterie gegenüber schlechten Kritiker*innen einhergeht. (6–7) Ohne dürftige Qualität im Rezensionswesen zu bestreiten, führt Chu diese dagegen auf prekäre Arbeitsbedingungen zurück. Ihre Einsätze will sie dabei aber nicht als Plädoyer für krampfhaft politische Kunst missverstanden wissen. Das Kunstwerk bleibe für seine politische Rahmung auf die Kritik – die selbst als Handwerk oder höchstens als niedrigste der Künste zu verstehen sei – angewiesen: „Art for art’s sake and criticism for the sake of everything else“. (9) Nicht Künstler*innen sollen sich an dem versuchen, was Chu mit Walter Benjamin als Politisierung der Kunst avisiert – Rezensent*innen sollen das tun. Statt engagierter Kunst geht es Chu also um engagierte Kritik. Letztlich mag die Idee, dass die Kunst frei flotieren soll, während die Kritik sie hermeneutisch erdet, in der undialektischen Gegenüberstellung, die sie aufmacht, zwar nur bedingt überzeugen; aber ihr politischer Vektor ist ein dringender, und nicht zuletzt wird dieser hier schön verargumentiert.
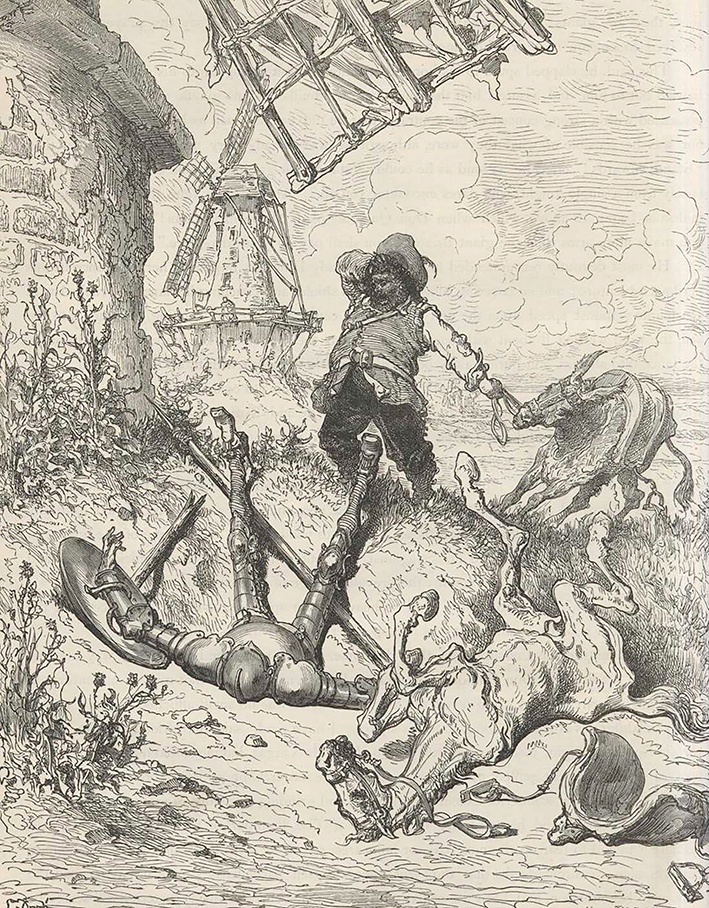
Gustave Doré, Illustration für „Don Quixote“, 1863
Die Grenzen von Chus Modell hängen indes mit ihrem bemühten Materialismus zusammen. Gewiss generiert Kritik Bedeutung; aber generiert sie nicht in erster Linie Wert? [10] Zumindest dem Anspruch nach reflektiert Chu dies. Die Meta-Autorität liege letztlich, das spoilert sie gleich im Vorwort, beim Geld („This for the reader eager to skip to the end, is the secret of all authority: money.“) (ix) Aber das allgemeine Äquivalent ist bei Chu weniger stummer Zwang als penetrantes Klirren der Silbergabel am Champagnerglas. Ihre Rezensionen strotzen von Romanautor*innen und ihren Figuren auf fancy Dinners (Yanagiharas von einer „tourist’s imagination“ gekennzeichneten Romane tragen beispielsweise den Stempel ihrer journalistischen Arbeit als „professional chronicler of wealth“. (26, 19) Das ist meist besser, als davon nicht zu erzählen. Aber der Materialismus verhallt darin; er redet sich den Mund fusselig für eine Editor of One’s Own, für die Bedeutung gut ausgestatteter Positionen im Rezensionswesen. [11] Während schmerzliche Prekarisierung unbedingt zu problematisieren ist, sollte die Kritik der Arbeitsverhältnisse hier nicht stehen bleiben, wie Chu es teils zu tun scheint.
Dazu – und zu ihrer wackeligen Analogie zwischen der zur Abstraktion lizensierten Kunst und der sie in der Konkretion erdenden Kritik mit Tausch- und Gebrauchswert (14) – passt, dass Chus finales Bild ungewöhnlich schief sitzt. [12] Im Nachwort sieht sie sich wie Don Quixote gegen Windmühlen anreiten. Kurz zuvor standen diese noch für die Kritik selbst, nun sollen sie wohl ihr Objekt sein (sowie das einer Aktivität jenseits des Schreibens): „For my part, I am with the old hidalgo. When he rode full tilt at that giant in disguise, he was acting on the correct assumption that reading was not enough. This, it seems to me, is the only way to do without authority: to go out and do it.“ (258) Ob sich die Kritikerin grundsätzlich eher auf die Seite des selbst ernannten Ritters als die seines frisch von den bäuerlichen Produktionsmitteln weggelockten Knappen schlagen sollte, sei dahingestellt. Dass sie nicht in kontemplativer Distanz verweilen, sondern – auch wo sie sich nicht völlig verständlich machen kann – gegen herrschaftliche Mühlen anstürmen sollte, leuchtet jedenfalls ein. Dass Quixotes Einzelritt ein gutes Bild für politische Aktion wäre, tut es weniger.
Andrea Long Chu, Authority: Essays, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2025, 288 Seiten.
Liola Mattheis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) Berlin, wo sie zu Entwicklungsbegriffen im Freudomarxismus forscht.
Image credits: 1. Alamy; 2. © Nick Morris; 3. © Farrar, Straus and Giroux; 4. Public domain
Anmerkungen
| [1] | So bringt sie es in dem Essay „The Pink“, der mühelos zwischen tragikomischer Schilderung der eigenen Vaginoplastie und Kommentierung feministischer Symbolik switcht, auf eine Formel. (Authority, 104). |
| [2] | Andrea Long Chu/Emmett Harsin Drager, „After trans studies“, in: TSQ: Transgender Studies Quarterly, 6.1, 2019, S. 103–16. |
| [3] | Siehe Eve Kosofsky Sedgwick, „Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Essay Is About You“, in: Novel Gazing: Queer Readings in Fiction, Duke University Press, 1997. |
| [4] | Allerdings wurde in Bezug auf Chus kontroverses Pamphlet Females die politische Funktion der Provokation triftig infrage gestellt; vgl. Kay Gabriel, „The Limits of the Bit“, in: LA Review of Books, 25.11.2019, sowie Juliana Gleesons beachtlich ausgewogene und historisierende Rezension („Are Jokes going to Cut It? Concerning Andrea Long Chu’s Females“, in: TSQ: Transgender Studies Quarterly, 2020). In einem selbstkritischen Nachwort zur Neuausgabe (Verso, 2025) erkennt Chu diese Vorwürfe größtenteils an (vgl. „Our Reasons: Females, six years later“, in: n+1, 05.03.2025). Auch in Authority stellt sie gelegentlich frühere Register der Provokation infrage. |
| [5] | Wenn die Nichtanerkennung der Trennbarkeit von Text und Welt gemeinhin für schlechte Lektürepraxis gehalten wird, so erscheint eine solche in Zeiten, in denen genozidale Kriegsführung durch interpretative Distanzierung gestützt wird, besonders dringlich. Das hat Chu anknüpfend an Isabella Hammad mit Bezug auf Israels Krieg in Gaza anderenorts überzeugend ausgeführt („In Praise of Bad Readers“, in: Vulture, 11.10.2024). |
| [6] | In einer etwas zynisch anmutenden Verdichtung ergänzt sie: „The real question is how to do it without resorting to the gulags.“ (58) Zu Fragen politischer Organisation und Strategie hat Chu bisher wenig zu sagen. |
| [7] | Wie z. B. Herbert Marcuses ideengeschichtlichen Beitrag in: Max Horkheimer (Hrsg.), „Studien über Autorität und Familie“, in: Schriften des Instituts für Sozialforschung [1936]. Rezensionen von Authority weisen auch auf die insgesamt bedauerlich selektive Referenzpolitik des Essays hin („it’s hard to ignore whom she leaves out of her version of history, those figures who might have had the right questions to pose for the problem at hand“, schreibt Kevin Lozano in The Nation; und Sam Huber bemängelt in The Yale Review die „conspicuous absence“ von feministischen Entwürfen kritischer Praxis aus den 1970ern). |
| [8] | Nachdem das Kulturzentrum 92nd Street Y den Autor Viet Thanh Nguyen aufgrund von dessen Engagement für eine Waffenruhe in Gaza ausgeladen hatte, kam es zu internem Protest und Kündigungen; das gesamte Herbstprogramm, in dem auch Chus Vortrag vorgesehen war, wurde abgesagt. (3–4). |
| [9] | „Der Krisenbefund gehört, so scheint es, zu den konstitutiven Ritualen der (Kunst-)Kritik selbst“, hatte Christian Liclair den Round Table zur für die Kritik zentralen Gattung der Rezension eröffnet. Texte zur Kunst, 131, 2023, S. 6–7. |
| [10] | So hatte das Vorwort zur Reviews-Ausgabe festgehalten, dass „der Rezension ein Wert generierendes Moment inne[wohnt]: Sie schafft einen Symbolwert, der sich unter Umständen in Marktwert transformieren lässt.“. |
| [11] | Dieser Vorwurf greift wohl auf, was S. C. Cornell in einer Rezension zu Authority scharf – wenn auch wohl etwas überzogen – herausgearbeitet hat: nämlich, dass Chu bei aller erklärten Liberalismuskritik selbst auf liberale Rhetoriken zurückfällt; „Andrea Long Chu Owns The Libs“, in: The New Yorker, 02.05.2025. |
| [12] | Dass Chus Zuwendung zu materialistischen Lektüren generell aber vielversprechend ist, zeigt sich auch in Texten, die nach Authority erschienen sind, wie z. B. in der kürzlichen Rezension zu Ocean Vuong; „The Romance of Being Unreadable“, in: Vulture, 06.05.2025. Vgl. auch das Nachwort zur ungefähr zeitgleich mit Authority erscheinenden Neuauflage von Females, wo Chu die politische Fragwürdigkeit des ontologischen Framings des Buches eingesteht: „What I do wish is that the book had been more historical, more materialist, more capable of explicitly connecting its transcendental concerns with the empirical situation at hand.“ |

