Hauptsache Performativ

Das Anspruchsvolle des von Erika Fischer-Lichte und Doris Kolesch herausgegebenen Sammelbands “Kulturen des Performativen”ist zugleich sein Problem: Das interessante Projekt, die verschiedenen “Begriffsabschattungen von Performativität” (S. 9) zu katalogisieren, steht immer wieder in der Gefahr, ganz Heterogenes als “performativ” zu beschreiben. Beim Lesen der einzelnen Beiträge des Sammelbands drängt sich der Eindruck auf, dass das vielversprechende Projekt sich seiner selbst nicht ganz sicher ist. Deshalb versucht es sich dadurch von der eigenen Wichtigkeit zu überzeugen, dass möglichst viel als performativ beziehungsweise in seinen performativen Dimensionen beschrieben wird: vom Minnesang [1] bis zu Talkshows [2] , Cyborgs [3] und der “Musterkunst bei den Kashinawa-Indianern” [4] , um nur einige Beispiele zu erwähnen. Das führt dazu, dass man am Ende den Eindruck hat, dass alles irgendwie performativ ist, und das wiederum läßt die ausgewählten Beiträge trotz ihrer brisanten Forschungsobjekte beliebig erscheinen.
Eine Bestandsaufnahme [5] mit dem Ziel, interdisziplinär “das Potential einer performativitätsorientierten Forschung zu erkunden” (S. 9), ist in meinen Augen nur dann sinnvoll, wenn sie auch deutlich macht, warum bestimmte Phänomene angemessener oder überhaupt erst beschrieben werden können, wenn man dies in der Begrifflichkeit der Performativitätstheorie tut [6] . Gerade von Spezialistinnen für den Zusammenhang von Zeichengebrauch und Wirklichkeitskonstitution ist darüber hinaus eine Reflexion darauf zu erwarten, bis zu welchem Punkt sie ihr gemeinsames Untersuchungsfeld auch erst konstruieren, indem sie Heterogenes mit identischen Begriffen belegen. Damit ist auf das Performativitäts-Verständnis von John L. Austin verwiesen, der den den Wirklichkeit setzenden und verändernden Aspekt des Sprechens gegen die Auffassung verteidigte, die Funktion der Sprache bestehe ausschließlich darin, die Welt zu beschreiben [7] . Wenn die Herausgeberinnen des Sammelbands im Vorwort schreiben, es gehe ihnen mit ihrer interdisziplinären Bestandsaufnahme darum, zu einem “‚performative turn‘ in den Kulturwissenschaften beizutragen” (S. 9), knüpfen sie allerdings kaum an Austin an, obwohl gerade er immer wieder zitiert wird. Der von Fischer-Lichte und Kolesch propagierte “performative turn” ist nämlich durch seine Opposition zu jenem “linguistic turn” definiert, zu dem wesentlich auch Austin beigetragen hat, indem er den wirklichkeitskonstituierenden Aspekt des Sprechens betont. An eben diesem “linguistic turn” ist nach Fischer-Lichte [8] performativitätstheoretisch zu kritisieren, dass mit ihm ein Verständnis von Kultur als Text einhergeht, dem nicht nur die interessantesten ästhetischen Phänomene in ihrer Flüchtigkeit und Körperlichkeit entgehen, sondern darüber hinaus (kulturelle) Praktiken als Praktiken überhaupt.
Um die eingangs angedeuteten Vorbehalte gegenüber dem begriffsklärenden Potential des Sammelbands von Fischer-Lichte und Kolesch zu erläutern und die polemische Gegenüberstellung von “performative turn” und “linguistic turn” zu befragen, möchte ich im folgenden – und damit werde ich einem beträchtlichen Teil des Sammelbandes natürlich nicht gerecht – hauptsächlich vom Bereich der “ästhetische(n) Praktiken von Performances als Inszenierung” (S. 9) aus fragen, welche unterschiedlichen Bedeutungen des Performativen hier relevant sind; wie produktiv es ist, verschiedenste Dimensionen ästhetischer Performance-Praktiken “performativitätsorientiert” (S. 9) zu beschreiben; ob diese Spielarten von ästhetischer Performativität zur allgemeineren Performativität (nicht-)sprachlicher Vollzüge in ein Verhältnis gesetzt werden.
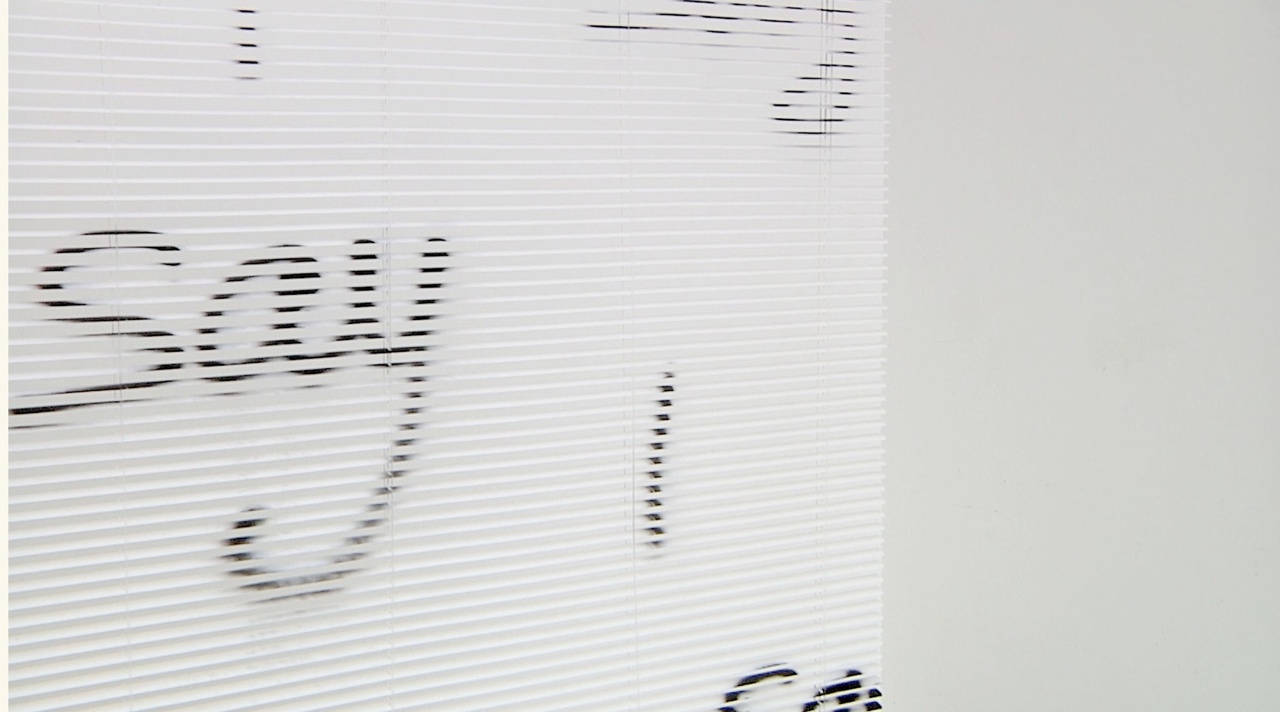 Nicole Bachmann, „I SAY", 2017, Filmstill
Nicole Bachmann, „I SAY", 2017, Filmstill
Fischer-Lichte verwischt in ihrem einführenden Text “Auf dem Wege zu einer performativen Kultur” [9] die Differenz zwischen der allgemeinen Performativität von (sprachlichen) Handlungsvollzügen und ästhetischen Performances von Anfang an. Sie geht davon aus, dass eben das, “was Austins Sprechakttheorie für die Erkenntnis von Sprache leistete” (S. 24) – nämlich daran zu erinnern, “dass Sprache nicht nur eine referentielle Funktion erfüllt, sondern immer auch eine performative” (S. 24) –, im Bereich des Theaters seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch das Theater selbst erkannt und praktiziert wurde, und zwar durch seine Transformation in Performances und Happenings. “Während die referentielle Funktion” im Theater “auf die Darstellung von Figuren, Handlungen, Beziehungen, oder Situationen bezogen ist, richtet sich die performative auf den Vollzug von Handlungen – durch die Akteure und zum Teil auch durch die Zuschauer – sowie auf ihre unmittelbare Wirkung." (S. 14) Um diese Unterscheidung zu erläutern, kommentiert Fischer-Lichte “ein sogenanntes ‚untiteld event‘” (S. 13), das 1952 von John Cage, David Tudor, Jay Watts, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, Charles Olsen und Mary Caroline Richards im Speisesaal des Black Mountain Colleges veranstaltet wurde. (Vgl. S. 13 f.) Das für die Frage des Performativen Bemerkenswerte an diesem “untitled event” besteht nach Fischer-Lichte darin, dass es nicht um fiktive Charaktere, fiktive Räume und Zeitabläufe ging, sondern um die gleichzeitig von verschiedenen Künstler/innen vollzogenen Aktionen. (Vgl. S. 15f.) Demnach ist unter “Referenz” offenbar ein fiktionaler Bezugspunkt beziehungsweise eine Darstellungsrelation zu verstehen, die Doris Kolesch in ihrem Beitrag als die in westlichen Kulturen übliche Auffassung von Theater überhaupt bestimmt: “eine Person A verkörpert an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit eine Figur X vor den Augen von gleichzeitig anwesenden Zuschauern.” (S. 181) Man könnte nun natürlich bezweifeln, ob es eine derart simple Vorstellung von Theater, wie Fischer-Lichte und Kolesch sie als Hintergrund ihrer Überlegungen voraussetzen, jemals gab, ob zum Spielen von fiktiven Rollen nicht immer auch das Oszillieren zwischen Rollenspielen und Sich-selbst-Spielen gehörte. Wichtiger scheint mir jedoch, darauf aufmerksam zu machen, dass in Fischer-Lichtes Text immer wieder von einem zweiten Referenzbegriff die Rede ist, der mit dem eingangs als fiktional definierten nichts zu tun hat – ein Referenzbegriff, der demjenigen zu entsprechen scheint, was wir alltagssprachlich mit “Bedeutung” meinen [10] . Wenn man die beiden von mir unterschiedenen Referenzbegriffe auseinanderhält, könnte man sagen, dass das “untitled event” zwar keine Fiktionsreferenz hatte – Cage etwa spielte nicht jemand anderen, sondern allenfalls sich selbst –, dass aber damit das Feld nicht ausschließlich dem “Vollzug” überlassen war, sondern die Meister Eckhart-Auszüge, die Cage während des “events” vorlas, vielmehr ebenso wie andere gesprochene, zitierte, vorgelesene ... Sätze durchaus Referenz im Sinn von Bedeutung hatten. Und natürlich sind auch die Alltagsgegenstände wie Tassen und Stühle, die nach Fischer-Lichte im “untitled event” eine entscheidende Rolle spielten, nicht jenseits von – ohne Sprache schwer denkbaren – Bedeutsamkeitszusammenhängen identifizierbar. Mit anderen Worten: Man kann nicht einfach die Referenz dem Vollzug gegenüberstellen, wie Fischer Lichte es in ihren Hauptthesen und Definitionen immer wieder tut, vielmehr sind viele Handlungsvollzüge, gerade auch diejenigen des “untitled event”, von Referenz im Sinn von Bedeutung und Bedeutsamkeit überhaupt nicht abzulösen. Das scheint mir auch der Punkt von Ekkehard Königs sprachtheoretischen Überlegungen, wenn er schreibt, dass “durch die Gleichsetzung von ‚performativ‘ mit ‚nicht-referentiell‘ die Gefahr” besteht, das wesentliche Anliegen von Austin aus den Augen zu verlieren. (Vgl. S. 69)
Aber nicht nur die Rolle von sprachlichen Elementen gerade im “untitled event” lassen die Alternative Referenz versus Vollzug bzw. “lingustic turn” versus “performative turn” problematisch erscheinen, sondern auch die Bezugnahme des “untitled event” auf diverse ästhetische und nichtästhetische Kontexte, womit ein weiterer, ebenfalls nicht-fiktional verstandener Referenzbegriff geltend gemacht ist, der auch bei Fischer-Lichte im Spiel bleibt – wenngleich nicht unter diesem Namen. Selbst wenn es zutrifft, dass Performance-Kunst mit der Fiktionalität bestimmter Theaterauffassungen bricht, so ist in meinen Augen absolut fraglich, ob es damit der Performance-Kunst nur um die “Ereignishaftigkeit ihrer selbst und unsere Teilhabe in dem Sinne, als sie eben nicht ein Anderes, Bestimmtes, außerhalb Existierendes bedeutet” (S. 162), geht, wie Christel Weiler den Gedanken von Fischer-Lichte radikalisiert. Insbesondere wenn man bedenkt, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil dessen, was bei Fischer-Lichte unter Performance-Kunst fällt, gerade auch deren politische und/oder institutionelle Bedingungen und Kontexte thematisiert und inszeniert, ist die Unterscheidung zwischen fiktionaler Referenz einerseits, und einer Ereignishaftigkeit ohne Außen andererseits, als Beschreibung der zur Diskussion stehenden ästhetischen Phänomene unzureichend.
 Nicole Bachmann, „I SAY", 2017, Filmstill
Nicole Bachmann, „I SAY", 2017, Filmstill
Problematisch sind aber auch Fischer-Lichtes Bemerkungen zur Rolle des Materials, der Gegenständlichkeit, zum Reflexivwerden der Wahrnehmung und Erfahrbarwerden der Zeitlichkeit etc. im “untitled event”. Solche Bemerkungen sind zwar jeweils überzeugende Kommentare zum “untitled event”, bei denen man allerdings oft nicht versteht, warum sie auf den immer gleichen Nenner des Performativen im Gegensatz zum Referentiellen gebracht werden müssen. Es fragt sich insbesondere, warum Kategorien wie “Reflexion”, “Materialität” – “ein Charakteristikum des Performativen liegt im Spiel mit Materialien”, bemerkt etwa auch Christel Weiler in diesem Sinn lapidar (S. 162) – etc. nicht ausreichen, um das zu beschreiben, worum es im “untitled event” geht. Hier stellt sich nicht nur die Frage, warum für alte Phänomene neue Begriffe verwendet werden, was ja eine durchaus erfrischende Sache sein kann, sondern vielmehr die, was mit welchem Recht in eine Schublade gesteckt wird. Bisweilen scheint mit dem “Performativen" in bezug auf ästhetische Phänomene nichts anderes als “Handlung” gemeint – etwa wenn über das “untitled event” gesagt wird: “Sie (= die beteiligten Künste, R. S.) privilegierten alle einen performativen Modus. Es wurde getanzt, Dichtung wurde vorgetragen ... ” (S. 19); manchmal geht es unter diesem Stichwort um das Ereignis zulasten des Artefakts im Sinn von Dramentexten, Librettotexten oder Partituren (vgl. S. 20), dann wieder um den Vorrang des Materials oder der Handlung vor der Bedeutung (vgl. z.B. S. 23) oder auch um die Aktivität und Freiheit der Zuschauer (vgl. 16 ff.), die wesentlich an dem beteiligt sind, was ein performatives Ereignis ist.
Die Frage, wie angemessen die uniforme performativitätstheoretische Begrifflichkeit ist, um die von Fischer-Lichte in Blick genommenen Dimensionen ästhetischer Phänomene zu kommentieren, stellt sich – auf ganz andere Weise – auch bei der Lektüre jener Beiträge [11] des Sammelbands, die eine ästhetisch verstandene Performativität in Texten entfaltet sehen, das heißt in jenen Artefakten, die Fischer-Lichte von den performativen Ereignissen aufs schärfste unterschieden wissen will, wie ihre Grenzziehung zwischen einer textuellen und einer performativen Kultur unzweideutig immer wieder deutlich macht [12] . Dass Fischer-Lichtes Charakterisierungen von ästhetischen Performances größtenteils auch auf alle interessanten Texte zutreffen, heißt nicht, dass sie unzutreffend sind; es deutet vermutlich vielmehr darauf hin, dass sie nicht phänomenspezifisch genug sind, dass damit nämlich Produktions- und Rezeptionspraktiken erläutert werden, die weder auf ästhetische Performances eingeschränkt noch ausschließlich für die nichtästhetischen Objekte “performativer Kulturen” charakteristisch sind. Oder anders herum gesagt: Der Unterschied zwischen einer textuellen und einer performativen Kultur ist nur dann einer ums Ganze, wenn man einen aufs Fiktionale reduzierten Referenz- sowie einen objektivistisch verkürzten Textbegriff zugrundelegt. Auch die einfachste Texthermeneutik bestreitet nicht, dass Texte im Lesen konstituiert werden und ihr Sein im Interpretiertwerden haben, dass solche Prozesse kaum zu einem begründeten Ende kommen, dass diese Prozessualität etwas mit der Materialität zu tun hat.
Zweifel an der Begrifflichkeit des Performativen kommen einem schließlich auch angesichts der Tatsache, dass Fischer-Lichte den Einleitungsaufsatz zum Sammelband “Kulturen des Performativen” in fast wörtlicher Wiederholung auch ihrem um den Begriff der Theatralität zentrierten Sammelband “Theater seit den 60er Jahren” voranstellt, ihn dort lediglich um ein paar Bemerkungen zum Verhältnis von Performativität und Theatralität ergänzt, um am Ende als Forschungsziel die Frage festzuhalten: “Sind die Begriffe Theatralität und Performativität austauschbar, oder meinen sie jeweils etwas anderes (...)?” [13] Das spricht in meinen Augen – wie gesagt – nicht gegen die Brisanz und Aktualität der von ihr ins Zentrum gestellten Phänomene, sondern gegen die offenbar austauschbaren Begrifflichkeiten.
Doris Kolesch beginnt ihren Beitrag “Zur Theatralität nicht-theatraler Bilder. Überlegungen zu den Photographien von Cindy Sherman” mit der Bemerkung Austins: “Eines spricht jedenfalls für dieses Wort [= performativ, R.S.], nämlich dass es nicht tief klingt.” (zit. nach S. 180) Sie scheint davon auszugehen, dass diese Autor-Autorität ausreicht, um an der Einschätzung Austins, “performativ” erzeuge “keine Suggestion von Tiefe” (S. 180), trotz der Karriere dieses Worts während der letzten Jahre festzuhalten. Man kann in meinen Augen allerdings gerade an der Geschichte dieses Worts sehen, dass der inflationäre Gebrauch von Worten diese selbst ebenso verändert wie die Praktiken, deren Teil sie sind. Und das heißt: Man kann an eben dieser Geschichte sehen, wie “Performativität” in Austins Sinn funktioniert. Vieles spricht dafür, dass “Performativität” zu einer Tiefsinnskategorie geworden ist, ohne dass ihr Verhältnis zur spezifisch künstlerischen Performance geklärt oder absehbar wäre, inwiefern die mit dem Label des Performativen belegten Ereignisse in der Lage sein sollten, in ausgezeichneter Weise ein instruktiver oder gar kritischer “Metakommentar zu unserer Kultur” (S. 28) zu sein; zu einer Kultur, die Fischer-Lichte als eine „schier endlose Abfolge von inszenierten Ereignissen“ charakterisiert, im Zuge derer „sich eine ‘Erlebnis- und Spektakelkultur’ gebildet hat“. (S. 24) Solange man nicht Spezifischeres zu künstlerischen Performances oder nichtästhetischen Vollzügen und Praktiken sagt, als es bei Fischer-Lichte der Fall ist, erscheinen diese vielmehr wie schale Verdoppelungen unserer performativen Kultur als einer “Erlebnis- und Spektakelkultur”.
Ruth Sonderegger
Kulturen des Performativen, herausgegeben von Erika Fischer-Lichte und Doris Kolesch, Berlin: Akademie 1998 (= Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie, Band 7, Heft 1)
Titelbild: Nicole Bachmann, „I SAY", 2017, Filmstill
Notes
| [1] | Vgl. den Beitrag von Volker Mertens, S. 113 ff. |
| [2] | Vgl. den Beitrag von Hans J. Wulff, S. 215 ff. |
| [3] | Vgl. den Beitrag von Ulrike Brunotte, S. 197 ff. |
| [4] | Vgl. den Beitrag von Barbara Keifenheim, S. 265 ff. |
| [5] | Ihr liegt eine zweisemestrige Ringvorlesung zugrunde, aus der inzwischen ein Sonderforschungsbereich an der Freien Universität Berlin geworden ist. |
| [6] | Welche Beschreibungslücken die Rede von “Performanz” bzw. “Performativität” füllen kann, machen im vorliegenden Sammelband beispielhaft die sprachtheoretischen Überlegungen von Sybille Krämer und Ekkehard König im Anschluß an Austin klar, in denen jeweils auch deutlich wird, gegen welche Sprachkonzeptionen die verteidigten Begriffe gerichtet sind. |
| [7] | John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with words), bearb. von Eike von Savigny, Stuttgart 1992. |
| [8] | Vgl. dazu auch: Erika Fischer-Lichte: Notwendige Ergänzung des Text-Modells. Dominantenverschiebung: Der “performative turn” in den Kulturwissenschaften, in: Frankfurter Rundschau vom 23.11.1999, S. 20. |
| [9] | Dies ist der einzige Text, auf den sich mehrere Beiträge beziehen, woraus ich schließe, dass er eine Art gemeinsamer Hintergrund zumindest einiger Aufsätze des Sammelbands darstellt. |
| [10] | Von diesem Referenzbegriff ist immer dort die Rede, wo Fischer-Lichte die beschreibende oder Tatsachen behauptende Dimension von alltäglichen Äußerungen als die referenzielle bezeichnet. Vgl. dazu S. 23f. |
| [11] | Vgl z.B. den Beitrag von Ingrid Kasten über “Körperlichkeit und Performanz in der Frauenmystik” oder Gert Mattenklotts Aufsatz: “Performative Ästhetik zwischen Mallarmé und Einstein”. |
| [12] | Vgl. dazu z.B. S. 25 sowie Fußnote 8. |
| [13] | Vgl.: Erika Fischer-Lichte: Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur, in: Dies., Friedemann Kreuder und Isabel Pflug (Hg.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde, Tübingen und Basel 1998, S.17. |
