INTIMITÄT IM VERPIXELTEN MINIFORMAT Tyna Fritschy über „Intimacy: New Queer Art From Berlin And Beyond“ Im Schwulen Museum, Berlin

„Intimacy: New Queer Art from Berlin and Beyond“, Schwules Museum, Berlin, 2021, Installationsansicht
Am 21. Januar Punkt 19.00 Uhr wurde „Intimacy: New Queer Art From Berlin And Beyond“ auf dem Facebook-Livekanal des Schwulen Museums, Berlin, in einer digitalen Führung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Good evening! Welcome everybody!“, begrüßt uns Peter Rehberg, der Sammlungs- und Archivleiter des Museums und Co-Kurator der Ausstellung.
Ich bin nicht allein. 37 Augenpaare/Avatare, die pünktlich in die Ausstellungsführung einsteigen. Später 83 Augenpaare/Avatare, die der Kamera in einen mit Gymnastikmatten ausgelegten Raum folgen, einer raumfüllenden Videoinstallation von Vika Kirchenbauer. Sie zeigt eine auf einer Matte festgebundene Person, die von mehreren Performer*innen gekitzelt wird. Einstweilen klingt aus dem Off der Ausstellungsführung: „I thought we might have sound here. But we don’t have sound at the moment.“ Die Unterbrechungen der Live-Übertragung erfolgen im Zehn-Minuten-Takt. 49 Augenpaare/Avatare, die die ekstatische Szene Doron Langbergs bezeugen: das sexuell-lustvolle Treiben zweier Männer, „the potential of sex, a celebration“, wie uns gesagt wird. Es bleiben fragmentierte Momente, bizarr aneinandergereiht. Eine Modalität des Zeigens, die einlädt zum Rein- und Rauszappen.
Doch was heißt es, eine Ausstellungsbesprechung zu schreiben für eine Ausstellung, von der kaum etwas einsehbar ist? Was bleibt, ist dies: ein Pressetext, eine Liste der teilnehmenden Künstler*innen, zwei Videointerviews mit Florian Hetz und Kerstin Drechsel und die aufgezeichnete 53-minütige Eröffnungsführung, eine „tour de force“, wie Rehberg am Ende sichtlich erschöpft anmerkt.
Ich entscheide mich dagegen, eine Ausstellungsbesprechung zu schreiben im Modus des Als-Ob: als ob ich durch die im dreidimensionalen Raum angeordneten Werke gehen würde. (Eine Übung in Imagination, die mir mit einiger Anstrengung und dem richtigen Maß an Wiederholungen der Videoaufzeichnung tatsächlich gelingen könnte.) Stattdessen interessiert mich die Übertragung des Ausstellungsraums in die Digitalität, die hier – anders als andere Cyberpräsentationen von künstlerischen Produktionen unter Covid-19-Bedingungen – vom Versprechen lebt, dass der Ausstellungsraum dereinst wieder betreten werden kann. Ein bloßer Teaser, ein digitaler Blickfang, der die Körper in einer unbestimmten Zukunft im analogen Raum zu versammeln verspricht. Der Begriff des Ausstellungsdisplays erhält somit in der digitalen Übertragung eine neue Bedeutung. Mein individuelles Display-Device: ein hoch aufgelöster 13-Zoll-Laptop-Bildschirm, der das in Echtzeit mit einem Handy produzierte Video in der lächerlichen Größe von 17 x10 cm wiedergibt. Warum in Hochformat, frage ich mich. Dem verpixelten Miniformat zum Trotz: Ich habe es mit einer sensorisch-assoziativen Überreizung zu tun. Ein Angriff auf die Rituale des Ausstellungsbesuchs.
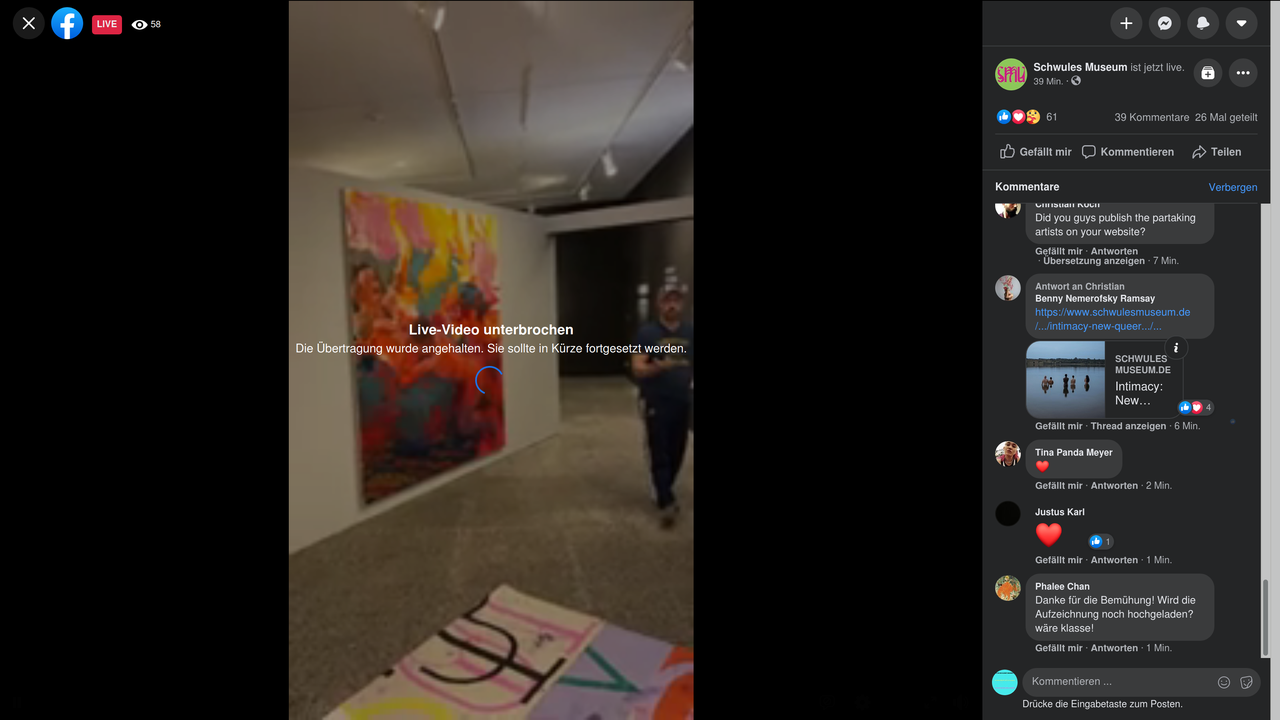
Digitale Eröffnung von „Intimacy: New Queer Art from Berlin and Beyond“ am 21.01.2021 im Schwulen Museum, Berlin, Screenshot
Mit „Intimacy“ bemühen sich die Kuratoren Peter Rehberg und Apostolos Lampropoulos darum, das Schwule Museum zu einem attraktiven Schauplatz der Berliner Kunstproduktion zu machen; es ist ein Bemühen, das auch schon in früheren Ausstellungen des Museums, wie in „Odarodle“ (2017) und „Das weiche G“ (2017), erkennbar war. Es geht darum, eine Relevanz für das Schwule Museum geltend zu machen, die weit über die eines „Heimatmuseums“ für Schwule, Lesben, Trans* und Queers, die sich in der 36-jährigen Geschichte des Museums mal in separatistischer Abgrenzung zueinander, mal in solidarischer Vereinigung miteinander befanden, hinausreicht – eine Relevanz also auch jenseits der queeren Community.
Die Kamera verweilt durchschnittlich zwischen fünf und elf Sekunden auf einem Werk. Del LaGrace Volcanos Fotografie Matt & Eric, die aus einer Porträtserie aus den 1990er Jahren stammt, gewährt sie 18 Sekunden. Andere Werke von international bekannten Ikonen der queeren Kunstproduktion – AA Bronson, Zanele Muholi, Marlon Riggs, Paul Mpagi Sepuya, Tejal Shah – huschen über meinen Bildschirm wie die Werke der lokalen Chronist*innen des queeren Lebens von Berlin: von Sholem Krishtalka, Spyros Rennt, Studio P-P, Florian Hetz, Rafael Medina, Victor Luque und Kerstin Drechsel.
Verheißend – es bleibt bei einer Verheißung, denn zu sehen gibt es in der Videoübertragung leider nichts – ist die experimentelle Videoarbeit At the Beach 2 (2017) der griechischen Künstlerin Eva Giannakopoulou, die queere Körper an einem Urlaubsstrand auf die normative Gewalt des heterosexuellen Blickregimes und des heterosexuell-bürgerlichen Beziehungsregimes, der Kernfamilie, treffen lässt. Andere Arbeiten explorieren Ambivalenzen und Verwundbarkeiten: die existenzielle Verwundbarkeit schwuler AIDS-Kranker in Simon Fujiwaras Study for My Martyrs I–VI (a Mural) (2020), die Verwundbarkeit des Älterwerdens als Trans*, das die Künstlerin Roey Victoria Heifetz in einer großformatigen Zeichnung thematisiert, und die Ambivalenz einer zwischen Lust und Terror changierenden Intimität, die Vika Kirchenbauer und Cibelle Cavalli Bastos in ihren sehr unterschiedlichen, aber gleichermaßen spielerischen Arbeiten The Island of perpetual tickling (2018) und Hardcore Cuddling (2020) ausloten. In der digitalen Vermittlung ist der Metatext zu den Arbeiten zugänglicher als deren ästhetische Form. Es droht daher – auch in dieser Ausstellungsbesprechung – die Überbetonung der inhaltlichen Aspekte.
Im aufgezeichneten und auf Facebook archivierten Künstler*inneninterview im Ausstellungsraum spricht Kerstin Drechsel über ihre groß- und kleinformatigen Malereien, die sexuelle Szenen zwischen Frauen im semi-öffentlichen Raum des Berliner Darkrooms Ficken 3000 darstellen: Er ist einer der wenigen Darkrooms, die allen Geschlechtern und Sexualitäten offenstehen. Oder aus derzeitiger Sicht: mal offenstanden. „DAS FICKEN 3000 BLEIBT CORONABEDINGT VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN“, heißt es auf der Website.
Eine Ausstellung über queere Intimität unter dem Eindruck der Pandemie: Balsam für die Seele oder konzeptioneller Fehlschlag? „Intimacy is in crisis“, so Rehberg. Besonders queere Intimität. Die heteronormative Lockdownpolitik ist ein Teilungsapparat, der legitime von illegitimen Intimitäten unterscheidet. Als legitim wird dabei diejenige Intimität behauptet, die in Ehe oder dyadischer Partner*innenschaft – als Konkubinat oder aufgeteilt auf zwei Singlewohnungen – stattfindet. Illegitim sind alle anderen: tentakuläre Verbandelungen, flüchtige Kontakte, soziale Komplexitäten, die sich der sexuellen Erfindungsraft queerer Communities verdanken.

„Intimacy: New Queer Art from Berlin and Beyond“, Schwules Museum, Berlin, 2021, Installationsansicht
Konzipiert wurde die Ausstellung noch vor der Pandemie. Und jetzt? „They’re also a kind of reminder of the times before Covid, of how life was like before Covid. And I think they also present a certain kind of vision what will happen again“, sagt Rehberg Eine Hoffnung, die auf den Glauben gründet, dass die Pandemie dereinst für beendet erklärt werden kann und dass die Social-Distancing-Disziplinierung der Körper und die Technisierung des Sozialen unsere Nahbeziehungen, aber auch Haptik und Sinnlichkeit, nur temporär, aber nicht dauerhaft umarbeiten. Wahrscheinlicher erscheint mir: Intimität wird nach der Pandemie nicht mehr dieselbe sein.
Denn es sind genau diese Widersprüche, die die medial-performativen Geschehen rund um die Eröffnung von „Intimacy“ nur unzureichend reflektieren: Intimität wird hier verstanden als etwas Fleischliches, Distanzloses. Doch die Werke antizipieren kaum die Veränderungen in der Grammatik der Intimität, die wir gerade bezeugen: dass Intimität (zunehmend) technologisch assistiert wird und die Silikon-Valley-Technologie der digitalen Devices und Displays unsere Kontaktorgane erweitern, ersetzen, destabilisieren. Davon finden sich in „Intimacy“ nur wenige Spuren: ein Mobiltelefon, das in der Bettszenerie eines Bildes von Sholem Krishtalka auftaucht; die Einladung zu einer auditiven Intimität von George Le Nonces Gedichten; die technoökologischen Schöpfungen von Tejal Shah. Rehbergs Kommentar: „Undefined joy.“
Shahs zwischen Fotografie, Video und Installation angesiedelten Arbeiten spannen den Begriff des Intimen in der Ausstellung am weitesten. Queere Sexualität ist in Shahs bisherigem Schaffen – etwa in Between the Waves, einer Mehrkanal-Videoinstallation, die erstmals bei der Documenta 13 im Jahr 2012 zu sehen war – der Code für wechselnde Intimitäten zwischen Menschen, Pflanzen, Fabelwesen, unbelebter Materie, humananimals und prothetischen Gestalten. Shah eröffnet damit radikale Vorstellungswelten, die die Ausstellung ansonsten vermissen lässt. Das Spekulative daran ist vielleicht ein allgemeineres Kennzeichen ästhetischer Neuerfindungen einer jüngeren Generation von Kunstschaffenden, die das Queere mit dekolonialen Wissenspraktiken zu verbinden versuchen und die Grenzen zwischen ästhetischer Produktion, forschender und – im Sinne indigen-schamanistischer Formen des Umgangs mit kolonialer, kapitalistischer und patriarchaler Ausbeutung – heilender Praxis verschwimmen lassen.
Der Berliner Kunstraum District hat sich – beispielsweise mit der Programmschiene „The Many Headed Hydra“ – in den letzten Jahren als lokales Laboratorium solch ästhetischer, narrativer und diskursiver Experimente einen Namen gemacht. „Intimacy“ wirkt im Kontrast dazu wenig couragiert und eher konventionell. Gewiss: Die Show ist üppig, doch der Spagat zwischen dem Feiern eines sich aus lokalen Szenen generierenden Kunstschaffens und dem Versprechen einer ästhetischen Neuheit – das Versprechen des new im Untertitel – will nicht so recht gelingen.
„Intimacy: New Queer Art From Berlin And Beyond“, Schwules Museum, Berlin, 03. Dezember 2020 bis 30. August 2021.
Tyna Fritschy ist freischaffende Theoretiker*in und forscht an der Schnittstelle von politischer Philosophie, queer-feministischer Theorie und postkolonialer Theorie und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen von Care, Köperpolitiken, Eigentum und Produktionsverhältnissen.
Image credit: 1. und 3. Schwules Museum/L* Reiter; 2. Tyna Fritschy
