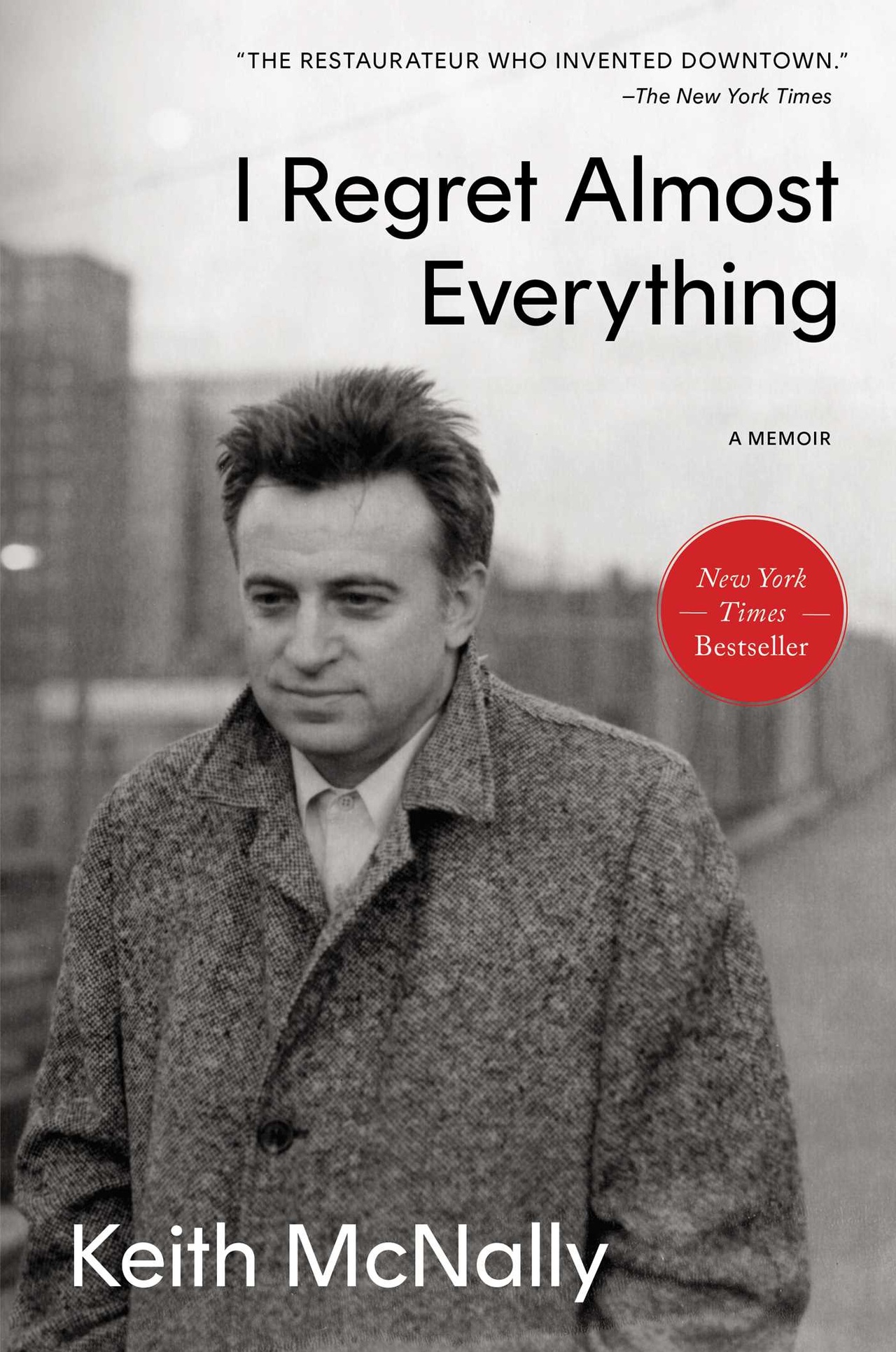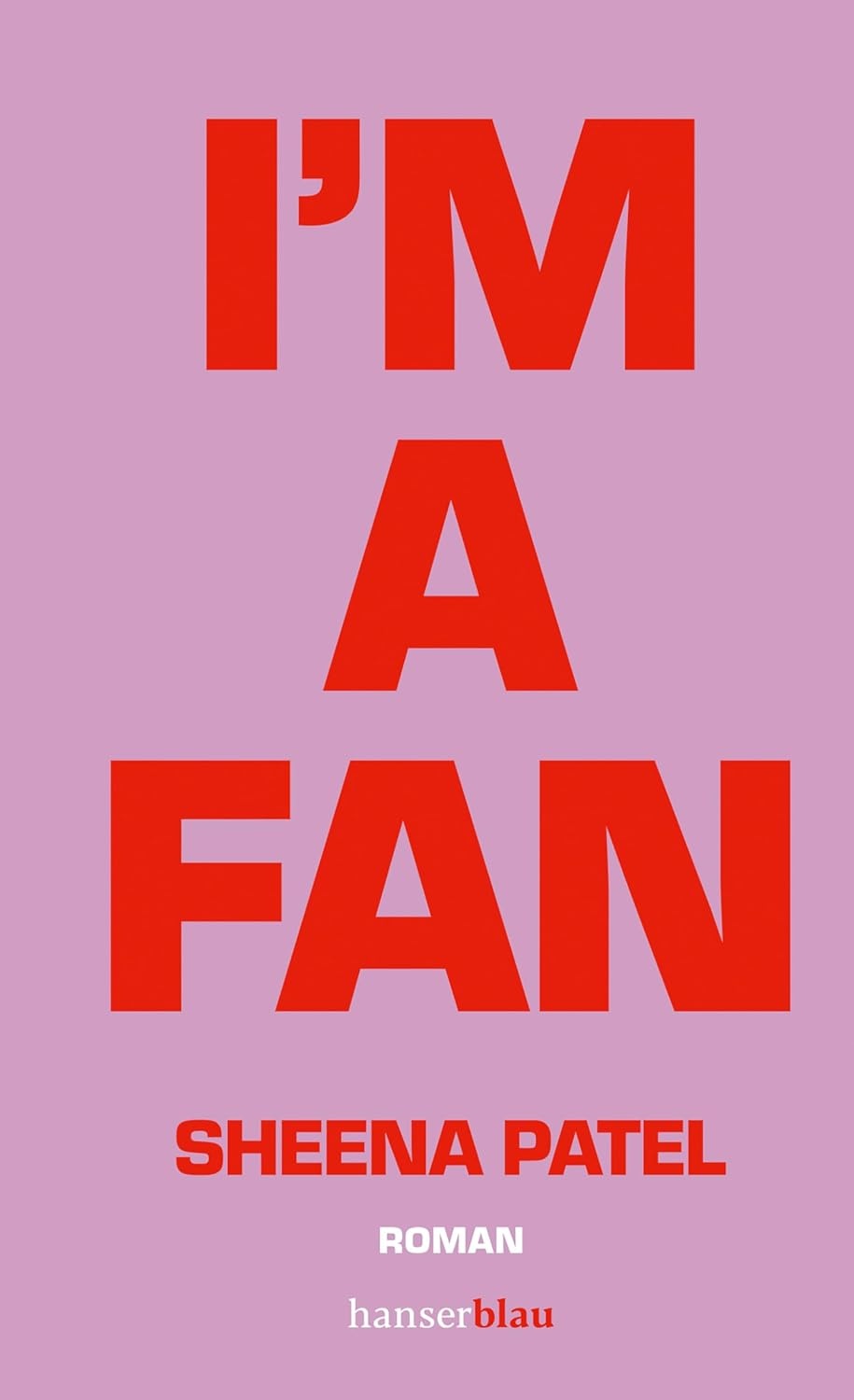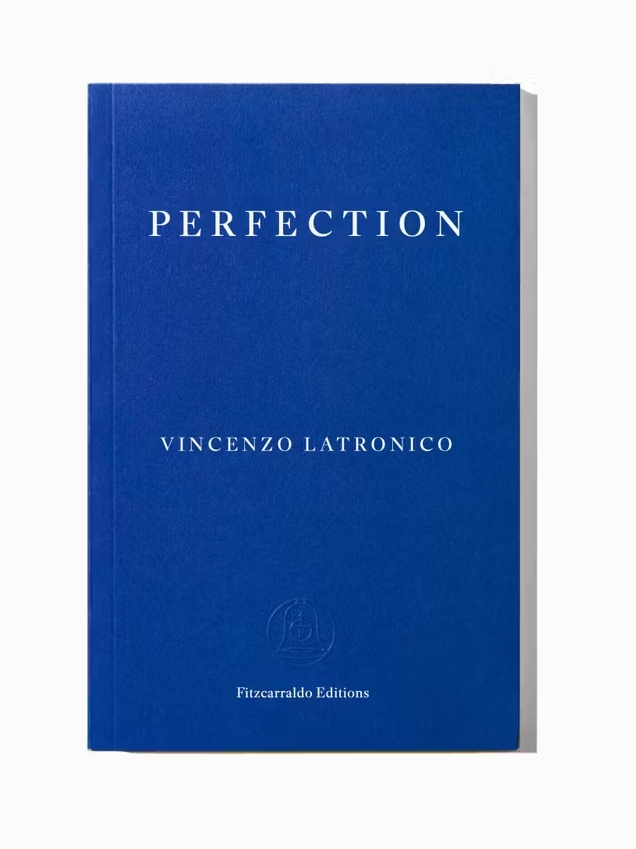Zur Sommerlektüre empfiehlt Isabelle Graw im Folgenden drei Pageturner, die widersprüchliche Figuren umkreisen: Das erste Buch – Bekenntnisse des erfolgreichen Gastro-Entrepreneurs Keith McNally – überrascht mit dessen selbstkritischen Überlegungen. Im zweiten oszilliert Sheena Patels Protagonistin zwischen Selbsterniedrigung und Gesellschaftsanalyse. Mit dem dritten nähert Vincenzo Latronico sich anhand eines schablonenhaft gezeichneten Expat-Paars der kreativen Szene Berlins.
Keith McNally, I Regret Almost Everything
Schon der Titel dieses Buches ist vielversprechend – entgegen Édith Piafs „Non, je ne regrette rien“ behauptet Keith McNally, fast alles in seinem Leben zu bereuen. Dennoch liefert dieses Memoir keinen verbitterten Rückblick, sondern liest sich wie ein mitreißend geschriebener Pageturner. Sein Autor ist ein bekannter New Yorker Restaurateur, der seit den 1980er Jahren ein hippes Restaurant nach dem anderen in Downtown Manhattan eröffnet hat, vom The Odeon über Pastis und Lucky Strike bis hin zum legendären Balthazar. Auch der berühmte Club Nell’s ging auf die Initiative von McNally und seiner Exfrau Lynn Wagenknecht zurück. In letzter Zeit musste er jedoch zahlreiche Schicksalsschläge einstecken, die in diesem Buch verarbeitet werden. So hatte er vor ein paar Jahren einen Schlaganfall, der zur Lähmung seines rechten Armes führte und sein Sprechen bis heute beeinträchtigt. Die anschließende Trennung von seiner zweiten Frau setzte ihm ebenfalls so sehr zu, dass er einen Suizidversuch unternahm, der zum Glück misslang. Beeindruckend ist, wie schonungslos selbstkritisch dieser Autor auf sein Leben (und sein Handeln zurückblickt. So geißelt er sich zum Beispiel dafür, seiner Exfrau in Anwesenheit der gemeinsamen Kinder die Schuld an der Trennung gegeben zu haben. Rückblickend findet er es allerdings sogar nachvollziehbar, dass seine beiden Ehefrauen ihn verlassen haben; sei er doch oft mental abwesend gewesen und habe die Familien vernachlässigt. Dank detaillierter Beschreibungen seiner unternehmerischen Initiativen lässt sich McNallys Buch auch als eine Anleitung zur Gründung erfolgreicher Restaurants lesen. So ist es ratsam, wie McNally viel Aufwand für die Einrichtung zu betreiben, um etwa in ganz Frankreich ausgesuchte Möbel aufzustöbern. Im Balthazar optierte er für einen großen Spiegel und Seitenbeleuchtung, da dies der Stimmung zugutekomme. Zu viele Fenster dürfe es hingegen nicht geben, denn ein Restaurant bilde im Idealfall seinen eigenen sozialen Kosmos heraus. Dass McNally seinen Freund Woody Allen mit Blick auf die Missbrauchsvorwürfe von dessen Adoptivtochter leichtfertig von jeder Schuld freispricht, weist ihn als bohemistisch-transgressiven Heteromann der 1980er Jahre aus. Überraschend ist jedoch, dass er sich zugleich prinzipiell auf die Seite von Me-too schlägt. Es sind auch derartige Widersprüche, die das Buch zur fesselnden Strandlektüre machen.
New York: Gallery Books, 2025, 320 Seiten.
Sheena Patel, I’m a Fan
Dieser innere Monolog hat es in sich. Denn wie schon Chris Kraus in I Love Dick (1997) schreckt auch die Protagonistin dieses Buches nicht vor massiver Selbsterniedrigung zurück. Sie klammert sich an einen reichen weißen Mann, obwohl dieser offensichtlich auf keine ernsthafte Beziehung, sondern nur eine unverbindliche Affäre aus ist. Auch stalkt sie dessen andere Geliebte – eine wohlhabende und erfolgreiche Influencerin –, von der sie geradezu besessen ist und die sie wie ein durchgeknallter Fan verfolgt. Entscheidend ist jedoch, dass diese Protagonistin – und dies im Unterschied zu der von I Love Dick – auch die strukturellen Gründe für ihr Verhalten explizit reflektiert. In einer Gesellschaft, in der der „lebendige Puls des Faschismus“ schlage, toleriert von einer Bevölkerung, die zu keinem kritischen Gedanken mehr fähig sei, würde nur noch die Position des ultimativen Fantums bezogen. Dass die Protagonistin nach einem vergleichbaren Ruhm wie besagte Influencerin strebt, erklärt sie sich darüber hinaus mit der Struktur der sozialen Medien und deren „individualistischer, thatcheristischer und neokolonialer Politik“, die uns in „vorgeschriebene individuelle Marken“ verwandelt. Die Protagonistin ist also auch deshalb so sehr auf die Posts der Geliebten ihres Lovers fixiert, weil sie meint, hier lernen zu können, wie man online zu einer erfolgreichen Marke mutiert. Auch dass sie alles für die Fortsetzung der Affäre mit dem reichen Mann tut, führt sie auf die Struktur des Kapitalismus zurück. Denn vor den „ausbeuterischen neoliberalen Regimen“ der heutigen Zeit würden einen nur „ein Familienvermögen und luxuriös-asketische Wohnsituationen“ schützen – und genau diese Dinge verheißt der „Mann, mit dem sie zusammen sein will“. In einer Welt, in der nur das Geld zählt, käme es demnach einer Überlebensstrategie gleich, sich als die mittellose PoC, als die sie sich beschreibt, vor einem wohlhabenden weißen Mann in den Staub zu werfen. Obgleich ihr innerer Monolog zahlreiche scharfsinnige Überlegungen aufweist, kippt er doch zuweilen in antifeministischen Zynismus. Die Protagonistin hat offenbar ihren Glauben an Frauensolidarität verloren. Sobald Frauen um einen reichen Mann konkurrieren würden, „noch dazu, wenn er einen solchen Schwanz hat“, gäbe es keine Schwesternschaft mehr: „Wir fallen uns weiterhin gegenseitig in den Rücken, wir hätten uns verbünden sollen, aber wir kämpfen jede für sich allein.“ Zwar gibt es in zugespitzten Konkurrenzverhältnissen tatsächlich Anzeichen für diesen Rückfall in Einzelkämpferinnentum, aber das Wissen um diese „dark side of sisterhood“ (Jo Freeman), also um die Existenz von Neidgefühlen und Aggressionen unter Frauen, kann nach meiner Beobachtung andererseits dazu führen, dass diese nun erst recht zusammenhalten und sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Beeindruckend ist zuletzt die Schonungslosigkeit, mit der die Protagonistin ihre Erfolgsbesessenheit auf den Punkt bringt: Sie möchte endlich auch „sechsstellige Vorschüsse“ kassieren und nicht mehr „wie ein räudiger Hund nach Aufmerksamkeitsschnipseln“ lechzen. Im Unterschied zu jenen, die über gute Beziehungen und „eine PR-Frau“ verfügen, muss sie jedoch weiterhin jene Türen einschlagen, die sich anderen automatisch zu öffnen scheinen. Für die Autorin Patel scheint sich der Aufwand jedoch gelohnt zu haben, denn mit diesem Buch hat sie den ersehnten Durchbruch geschafft.
Hanser, 2023, 240 Seiten.
Vincenzo Latronico, Perfection
Dieses Buch stellt ein bemerkenswertes Update von Georges Perecs Les Choses (1965) dar. Denn auch Vincenzo Latronico erzählt das Leben eines Paares anhand von Dingen und Lebensgewohnheiten. Perfection gleicht einer ethnografischen Studie und zieht analog zum Nouveau Roman der Nachkriegszeit die minutiöse Beschreibung der konventionellen Erzählung vor. Programmatisch ist in dieser Hinsicht schon der Einstieg, eine seitenlange Deskription der Berliner Altbauwohnung besagten Paares – Anna und Tom – inklusive der für derartige Interieurs typischen Monstera-Pflanze. Nicht zufällig hat der Autor seinen beiden Figuren klassische Allerweltsnamen gegeben. Denn sie werden von ihm nicht als komplexe und in sich widersprüchliche Individuen, sondern als Prototypen der Spezies „kreative Expats“ in Berlin um 2015 gezeichnet. Vergleichbar dem Roman Allegro Pastell (2020) von Leif Randt, findet sich auch hier eine Fülle treffender soziologischer Beobachtungen. So wird für die Berliner Expat-Community beispielsweise festgestellt, dass hier Zuneigung und Unterstützung häufig Hand in Hand mit Schadenfreude gehen. Dass sich gerade vermeintliche „Freunde“ oft an unserem Scheitern erfreuen, ist wohl selten so nüchtern wie bei Latronico registriert worden. An anderer Stelle stellt der Erzähler trocken fest, das Wort Gentrifizierung würde beinahe ausschließlich von jenen verwendet, die sie selbst verursacht haben. Auch meiner Beobachtung nach kommt es nur wenigen Gentrifizierungskritiker*innen in den Sinn, dass sie selbst Teil des Problems sind. Anna und Tom arbeiten freiberuflich in der kreativen Szene und scrollen auf der Suche nach neuen Ideen und Inspiration ständig durch Instagram. Dem Erzähler zufolge ist es deshalb völlig undenkbar für sie, die Plattform zu verlassen. Anders als frühere Generationen, die über Filme, Bücher oder Politik diskutiert hätten, reden Anna und Tom mit ihren Bekannten vor allem übers Essen, was die allwissende Erzählstimme damit begründet, dass sie sich darüber definieren. Auch die Bilanz ihres Liebeslebens fällt einigermaßen ernüchternd aus: Zwar würden die beiden zusammen alt werden wollen, sie hätten jedoch selten und dann auch noch schlechten Sex miteinander. Spätestens an diesem Punkt fragt man sich, wieso der Erzähler seine Figuren so negativ festlegt. Auch können sie sich gegen seine deprimierenden Festschreibungen gar nicht wehren – ihr Handlungsspielraum wirkt extrem eingeschränkt. Gegen Ende des Romans geht der Berlin-Mythos zugrunde: Anna und Tom erleben, wie sich die Stadt verändert, wie der Möglichkeitsraum schwindet und die kreative Szene durch hohe Mieten und mangelnde Kitaplätze vertrieben wird. So kehren sie Berlin den Rücken zu, verbringen einen als trostlos geschilderten Sommer in Portugal und ziehen anschließend weg aus Berlin. Obwohl sie als Figuren zuweilen schablonenhaft wirken, gewinnt man durch die stereotype Überzeichnung ihres Verhaltens aber auch neue Einsichten. Als Titel für diese illusionslose Darstellung einer Expat-Existenz hätte ich Tocotronics „Bye Bye Berlin“ vorgeschlagen.
Fitzcaraldo Editions, 2025, 136 Seiten.
Isabelle Graw ist Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021), Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022) und Angst und Geld: Ein Roman (Spector Books, 2024).
Image credits: 1. © Rob Kulisek, Bildbearbeitung Hannah Bremer; 2. © Gallery Books; 3. © Hanser blau, 4. © Fitzcarraldo Editions